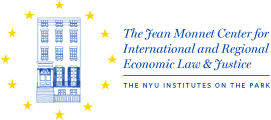
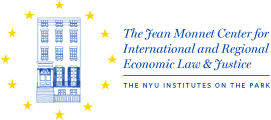 |
This paper is a part of contributions to the Jean Monnet
Working Paper
No.7/00, Symposium: Responses to
Joschka Fischer
Im Vorfeld des Gipfels von Nizza verschärft sich der Ton der Auseinandersetzung über die künftige Ausgestatlung des europäischen Institutionensystems. Im Mittelpunkt der Kritik stehen dabei die Visionen des deutschen Außenministers Joschka Fischer, der er erstmals am 12. mai dieses jahres an der Berliner Humboldt Universität präsentiert undkürzlich vor dem belgischenparlament wiederholt hat. Was dabei überrascht, sind weniger die skeptischen Töne aus Großbritanniene, als die ungewohnt scharfen äußerungen seitens des französischen Außenministers hubert Védrine. Dieser hat Fischer nichtnur wegen seiner visionären Gedankenspiele angegriffen, sondern auch dessen Vorschlag zurückgewiesen, inNIzza bereits eien weitere Reformkonferenz einzuberufen.
Ungeachtet dieser aktuellen Auseinandersetzungen, die auch vor dem Hintergrund der französischen Innenpolitik zu sehen sind, ist aber kaum zu bestreiten, daß über die Beschlüsse in Nizza hinaus weitere Reformen der Union erforderlich werden. Wenn man wie Fischer die Voraussetzung akzeptiert, daß die Erweiterung der Union nach Osten und Südosten politisch unabdingbar ist, ist eine Anpassung der Institutionen und des Integrationskonzepts an die neuen Gegebenheiten die notwendige Folge. Die Prinzipien und Maximen, die Fischer seinem Modell zu Grunde legt, finden sicherlich breite Zustimmung. Ziel einer Reform und Weiterentwicklung der europäischen Institutionen muß es sein, Europa auch dann handlungsfähig zu halten, wenn die Union 25 oder 30 Mitgliedstaaten umfaßt. In einer Föderation von Nationalstaaten muß Subsidiarität das oberste Prinzip sein für die Souveränitätsteilung, die vertikale Kompetenzverteilung zwischen den Nationalstaaten und der Ebene der europäischen Föderation. Und schließlich erscheint es bei der gegebenen ökonomischen und kulturellen Vielfalt der zukünftigen Mitglieder sinnvoll, Möglichkeiten einer differenzierten Integration ins Auge zu fassen, also zuzulassen, daß in manchen Bereichen nur ein Teil der Mitglieder eine gemeinschaftliche Politik betreibt. Andere Staaten beteiligen sich dann nicht, so wie das heute schon bei der Wirtschafts- und Währungsunion der Fall ist.
Allerdings belassen diese Grundprinzipien viel Spielraum für die konkrete Ausgestaltung der Institutionen. Fischers Vorschläge für das Institutionensystem sind sehr offen gehalten und sie bieten keine Lösungen für eine Reihe drängender Probleme der Union, die bei der nächsten Regierungskonferenz angegangen werden müssen. So bleibt etwa der Bestellungsmodus für eine "Europäische Regierung", ob fortentwickelte Kommission oder Minister aus den Nationalstaaten ebenso offen wie der Entscheidungsmodus in einem erweiterten Ministerrat oder einer föderativen Kammer. Beide Probleme müssen aber bereits heute gelöst werden, um die Handlungsfähigkeit der Union für die nächste Erweiterungsrunde zu gewährleisten. Darauf hat auch Védrine bereits hingewiesen. Außerdem impliziert das Modell Fischers eine Abkehr von der bisherigen Logik des politischen Systems der EU und ein teilweises Zurückdrehen des bisher Erreichten. Fischers Vorstellung erinnert in einzelnen Elementen, wie dem direkt gewählten Präsidenten oder einer zweiten Kammer nach dem Senatsprinzip, an ein präsidentielles System nach amerikanischen Vorbild. Bisher folgt das Institutionensystem der EU allerdings eher dem Muster der parlamentarischen Demokratie - ebenso wie die meisten Verfassungen in Europa. Ein parlamentarisch-demokratisches System hätte deshalb den Vorzug, den europäischen Bürgern vertrauter zu sein. Fischers Vorschlag bedeutet einen Bruch mit der institutionellen Tradition in der EU.
*First publication in Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt, Germany, 29.11.2000
** Max-Planck-Projektgruppe Gemeinschaftsgüter, Bonn
© Katharina Holzinger and Christoph Knill 2000