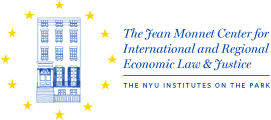
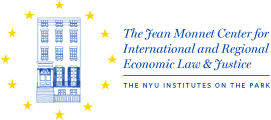 |
Zwei Begriffe von politischer Citizenship konkurrierten in Europa:
a) Die liberale Tradition, die Partizipation individualistisch und instrumentalistisch interpretierte und vor allem den Rechtsstaatsgedanken betonte. Seit die neuen Demokratien im Osten vielfach als "defekte oder illiberale Demokratien" endeten, die Partizipation in leidlich freien Wahlen erlaubten, aber den Rechtsstaat unterentwickelt ließen, gewinnt diese Konzeption wieder Oberwasser.
b) Die aristotelische Konzeption der ethischen und kulturellen Gemeinschaft-kulturell im Sinne der neueren Konzeption der politischen Kultur. Es wurden weniger die formalen Partizipationsrechte und die negativen Freiheitsrechte betont, als die "moeurs politiques". Der Kommunitarismus hat an diese Konzeption mit einem holistischen Konzept von Citizenship wieder angeknüpft (Taylor 1989, Habermas 1992:640f.). Kommunitarier sind keine Ethno-Demos-Patrioten und könnten sich mit dem Verfassungspatriotismus à la Habermas anfreunden. Aber sie haben ihn von der Enge des Rechtsstaats befreit und mit einem neuen partizipatorischen Pathos verbunden. Konzeptionen der "deliberativen Demokratie" oder der "reflexiven Demokratie" wurden publizistisch wieder belebt. Es gibt keinen Grundkonflikt zwischen diesen Konzeptionen mehr, wie ihn am Anfang des Liberalismus Benjamin Constant gegen die antike Bürgerschaftskonzeption formulierte, die er für Gesinnungstyrannis hielt. Der Kommunitarismus ist nicht nur selbstreflexiv, sondern auch selbstbeschränkend in seinen intellektuellen Ansprüchen, wenn Walzer und andere liberal genug sind, zu betonen, daß der Kommunitarismus nur die Übertreibungen des Liberalismus korrigieren will und sich nicht als neue dogmatische Lehre versteht.
Eine neue Bewegung ist in die etablierten Institutionen der liberalen Demokratie gekommen. Jahrelang hat niemand mehr die Alternativen für die verfassungsmäßige Weiterentwicklung der EU diskutiert, wie sie einst Bowie und Friedrich (1964) in den "Studies of Federalism" vornahmen, die Präsidentialismus, Parlamentarismus und Schweizer Ratssystem im Hinblick auf einen europäischen Föderalismus testeten. Neuerdings (Kohler-Koch 1999:9) wird Friedrichs Präferenz für das Schweizer Ratssystem wieder aufgenommen. "Opas Politikwissenschaft" des Altinstitutionalismus schien tot. Plötzlich kam der Paläoinstitutionalismus mit Ideen des "constitutional engineering" (Sartori 1994) wieder in Mode. Noch einflußreicher war der aufgeklärte Neoinstitutionalismus, der sich mit Handlungsoptionen von Akteuren im Mehrebenensystem befaßte, und sich zunehmend mit Rational Choice-Ansätzen verband, etwa bei Scharpf (1994b).
Die Praxis der Demokratien hat sich in Europa vielfach angenähert. Der Unterschied zwischen semipräsidentiellen und rein parlamentarischen Systemen ist zweitrangig geworden, angesichts der Entwicklungen der Parteien und ihren Interaktionsgewohnheiten mit den Medien.
Die Natur der europäischen Citizenship, die ex nihilo geschaffen wurde (Jesserum d'Oliveira 1994) bleibt unklar-wie die staats- und völkerrechtliche Qualität des Gebildes, das sein Substrat darstellt. Staatenverbund ist der deutsche Formelkompromiß. Er hat den Nachteil, außer im Schwedischen (statsförbundet) nicht übersetzbar zu sein. Aus allen wichtigen Sprachen käme die Übersetzung als Föderation oder Konföderation zurück.
Maastricht ist mehr als ein Vertrag und weniger als eine Verfassung. Einige sehen in diesem Vertrag eine Verfassung in nuce. Einige amerikanische Founding Fathers wollten ihre Verfassung "kurz und dunkel". Neue Verfassungen, wie die süd- und osteuropäischen Verfassungen sind "lang und dunkel" geworden, wenn etwa in Portugal die Dauer der Debatte einer Regierungserklärung geregelt wird, und die slowakische Verfassung damit beginnt, die Tradition des Großmährischen Reiches für sich in Anspruch zu nehmen.
Starbeispiel für die Tendenz zur Überlänge und Unklarheit ist das Subsidiaritätsprinzip in Europa. Es gelangte als Kompromißformel in die Verträge, weil vor allem Großbritannien keinen Anklang an föderales Vokabular duldete. Deutschland (neben Belgien) als einziger echter Bundesstaat unter den 12 Mitgliedern arbeitete unter dem Druck seiner Bundesländer mit an dieser Kompromißformel. Die führenden Unionsparteien hatten gegen den einst klerikalen Unterton der Formel seit "Quadrogesimo anno" weniger einzuwenden. In der Diffusion von Sozialstaatsideen war das Konzept für den Grundkonsens zwischen Christ- und Sozialdemokraten längst seiner vatikanischen Konnotationen entkleidet worden. Aber klarer war es mit der Übertragung von funktionalen Zusammenhängen auf territoriale keineswegs geworden.
Zu seiner Realisierung bedarf das Subsidiaritätsprinzip der Spezifizierung zwischen dem Ganzen und den Gliedstaaten. Scharpf (1991:421) hat mit Recht von "der Lebenslüge des Föderalismus" gesprochen. Bei verbalem Bekenntnis zu den größeren Residualkompetenzen der Gliedstaaten vollzog sich in allen Föderationen, außer der Schweiz, eine gewaltige Zentralisierung. Bei einer supranationalen Einheit, die als Wirtschaftseinheit ihre Karriere begann, ist dies a forteriori zu erwarten.
In einer Entschließung des Europäischen Parlaments zum Grundsatz der Subsidiarität vom November 1990 wurde bereits der Boden des Etikettenschwindels verlassen und klar konstatiert: "Die Föderalisierung der Ausübung dieser bereits auf Gemeinschaftsebene bestehenden Befugnisse wäre eine erste Antwort auf die Frage nach der Achtung des Grundsatzes der Subsidiarität, die somit eng mit der Beseitigung des Demokratiedefizits verbunden ist (EP-Doc. DE/RR/91692:6).
Stärker noch als das Föderalismusprinzip liegen Schranken gegen die Demokratisierung im Subsidiaritätsprinzip, das dem Ganzen nur in klar umrissenen Fällen einen legislatorischen Durchgriff auf alle Teile gestatten will. Sowie das Demokratiedefizit beschworen wird, kann man unter einem kaum kritisierbaren Etikett zentralisierende Tendenzen nur schwerlich aufhalten.
Es wäre jedoch ein Fehler, die Undeutlichkeit als Unvermögen der beteiligten Akteure zu brandmarken. Die Undeutlichkeit der Ziele hat im Vertrag von Maastricht vielfach ihre Vorzüge offenbart, wie Elmar Brok (1992) für das Europäische Parlament überzeugend argumentierte. Das Subsidiaritätsprinzip läßt vieles offen für den Kampf der Interessen. In Deutschland wird das Defizit an der Durchsetzung der reinen Lehre der Marktwirtschaft ohne Subventionen beklagt, aber das Subsidiaritätsprinzip als Schranke des EU-Durchgriffs beschworen, sobald einheimische Werften oder Kohlengruben in die Gefahrenzone geraten. Als ein founding father die Devise "kurz und dunkel" ausgab, lag eine ähnliche Sorge um die Undurchsetzbarkeit jeden Verfassungskompromisses zugrunde.
Die umstrittene Frage bleibt, ob die Vereinheitlichung der Rechtssysteme und der politischen Kulturen durch eine Verfassung gefördert werden kann. Die Antworten reichen von der Warnung vor überhöhten Erwartungen der Bürger, die eine Verfassung nach sich ziehen könnte (Grimm 1994:51) bis zur Betonung der Notwendigkeit einer Verfassung (Weidenfeld 1991), um die innere Einheit voranzutreiben. Für einige (Koch 1997) ist der Sprung in die "Revolution" einer Verfassung der Ausweg aus der Langeweile. Euroskeptiker wie Kielmannsegg (1995:237) sehen noch wenig Chancen für eine europäische Demokratie ohne europäische Identität und Zivilgesellschaft, ohne wirklich europäische Parteien und Interessengruppen. Andere Betrachter legen sich nicht genau fest (Pies in: Streit/Voigt 1996) und halten sowohl die Entwicklung eines Vertrages als auch eine Verfassung für einen gangbaren Weg. Funktionalestatt territoriale Repräsentation wird von einigen Experten (Kohler-Koch 1999:12) jedoch für die wahrscheinlichere Entwicklungslinie gehalten, um aus der Blockade zwischen demokratischem und föderalem Prinzip herauszutreten.
Der Konstruktivismus hat inzwischen die Theorie der Internationalen Politik erfaßt. Analysen der verfassungspolitischen Präferenzen der Mitgliedstaaten zeigten, daß nicht so sehr rationalistische Verfolgung von Machtinteressen, sondern institutionalisierte Wirklichkeitskonstruktionen die Verfassungsaußenpolitik in der EU prägen (Wagner 1999:435). Es ließen sich keine über Zeit stabile grundlegende Präferenzordnungen der Staaten nachweisen, wie sie die Neorealisten und Rational Choice-Theoretiker unterstellten. Wie zu erwarten war vor allem das Merkmal föderaler Staat/Einheitsstaat maßgeblich für die politische Kultur der Länder, in denen die Wirklichkeitskonstruktionen verankert sind. Ähnliches läßt sich auch für die Konzeption von Citizenship aufzeigen.
Die Euroskepsis erinnert in mancher Hinsicht an die Diskussionen des 19. Jahrhunderts für die Integration neuer Nationalstaaten.
a) Lorenz von Stein (1852:5) hielt Preußen einst nicht reif für eine Verfassung, weil es sozial zu heterogen war. Ähnliche Argumente tauchen hinsichtlich Europas auf. Aber Preußen sprach mit Ausnahme einiger östlicher Gebiete, die überwiegend zweisprachig waren, eine Sprache und ließ sich auf eine "erfundene preußische Tradition" bis zurück zum Ordensstaat lose ideologisch integrieren. Stein konnte noch hoffen, daß Preußens "Verfassungsunfähigkeit" Deutschlands Verfassungsfähigkeit stärken werde. Die Verfassungsfähigkeit des ganzen Europa bis zum Bug oder gar zum Ural wird hingegen von niemandem als günstigere Voraussetzung für eine Verfassung angesehen als das "Klein-Europa" von Maastricht.
b) Föderalismus und Parlamentarismus galten als unvereinbar-obwohl Saint-Simon schon 1814 die Gegenthese vertrat: eine europäische Föderation bedürfe zunächst der parlamentarischen Mehrheitsherrschaft. In der Paulskirche in Deutschland überwog die gegenteilige Ansicht vom Liberalen Welcker bis zum Konservativen Radowitz. Bismarck hat das Unvereinbarkeitstheorem trotz allgemeinem Wahlrecht gegen die Parlamentarisierung des Reiches nach 1871 ausgespielt. Konservative, wie Calhoun in Amerika oder Konstantin Frantz und Max von Seydel in Deutschland haben überwiegend die "concurrent majorities" gegen die parlamentarische Mehrheitsherrschaft gesetzt. Die Unvereinbarkeitsthese wurde selbst dann noch vertreten, als Australien und Kanada längst das Gegenteil bewiesen hatte. Aber der Parlamentarismus der "Kolonien" hatte keinen Bildungswert für die kontinentale Dogmatik und soweit man demokratischer Föderalist war, wurde eher das Schweizer Ratssystem oder das präsidentielle System der USA gefordert als ein parlamentarisches System.
Die neueren theoretischen Ansätze sehen ein "Paradox der Schwäche" (Edgar Grande), das sowohl den Staat als auch die Gesellschaft schwächt. Der Staat verliert an Steuerungsfähigkeit, da Globalisierung und Regionalisierung den bourgeois über den staatlich beengt lebenden citoyen hinauswachsen lassen. Die Gesellschaft verliert ebenfalls, da der Staat durch die Mehrebenenverflechtung weniger kontrollierbar wird (Zürn 1996:34). Da im Sinne Hirschmans voice schwieriger wird, ist exit zu einer empfohlenen Option geworden. Entweder wird ein Pluralismusmodell empfohlen, das die Analogien zur Staatsformenlehre aufgibt oder es wird eine Flexibilisierung verlangt, die in einem System von Vetorechten besteht (Abromeit 1998:89).
Zur Zeit steht nur die Europäische Grundrechtcharta auf dem Programm. Seit 1984 sind Initiativen des Europäischen Parlaments in diese Richtung verzögert worden. Nun wird die Charta bis Ende 2000 erhofft. Die Auffassungen variieren von einer Kopie der Europäischen Menschenrechtskonvention bis zu einem neuen Grundrechtskatalog mit vielen sozialen Grundrechten. Problem wird die Frage bleiben, ob die Mitgliedstaaten zur Einhaltung dieser Rechte mit Sanktionen gezwungen werden können und wie weit das Klagerecht gegen Grundrechtsverstöße beim Europäischen Gerichtshof ausgebaut werden soll, ohne welche die Charta zur symbolischen Politik degradiert würde. Teile der Hessischen Verfassung sind immer wieder für nicht grundgesetzkonform angesehen worden, dennoch wurde auf Hessen kein Druck zur Amendierung ausgeübt. In Rußland enthalten 20 von 21 Republik-Verfassungen Klauseln, die unvereinbar mit der Föderationsverfassung sind. Die Union kann nicht einmal schwerwiegendere Verletzungen der Bundestreue sanktionieren-außer in Tschetschenien, wo es um förmliche Sezession geht. Europa wird es nicht besser gehen!