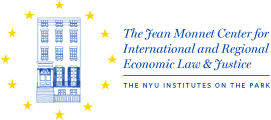
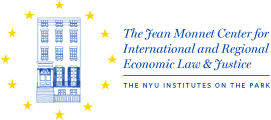 |
Ulrich R. Haltern , LL.M. (Yale)[ 1]
©Copyright: Ulrich R. Haltern, 1996.
I.Pluralismus von Pluralismen und deutscher Neo-Pluralismus
III. Integration und die Frage des "underlying consensus"
IV. Heteronome und autonome Integration: Konzepte substantiellen Konsenses
V. Rhetorische Integration und das Beispiel der Parteien
VI. Konsequenzen für den Staat 1: Parlament und Regierung
VII. Konsequenzen für den Staat 2: Bundesverfassungsgericht
VIII. Pluralistische Theorien der Verfassungsgerichtsbarkeit
Vielleicht hatte das Stichwort der Postmoderne nur eine andere, variantenreichere Beschreibung der Moderne versprechen wollen, die ihre eigene Einheit nur noch negativ vorstellen kann als Unmöglichkeit eines métarécit.
Niklas Luhmann[ 2]
It is plausible that the only consensus we have, and we do not always have even it, is that which Hobbes claims. We almost all prefer order to anarchy. But ... that is no very specific point of agreement ... And there are times when even this much is not in agreement...
Russell Hardin[ 3]
Die Frage, wie sich moderne Gesellschaften integrieren, ist ebenso wie die Schwierigkeit gesellschaftlicher Repräsentation ein Thema, das in engem Zusammenhang mit der Entwicklung einer fortschreitenden Moderne steht und dementsprechend breite Aufmerksamkeit gefunden hat.[4] Auch die Rechtswissenschaft sieht sich mit dem Problem konfrontiert und hat sich seiner angenommen. Waren in der Weimarer Republik Rudolf Smends[ 5] Gedanken von der Integrationskraft der Verfassung (und vor allem der Grundrechte) noch von der Verfassungswirklichkeit, in der sich sogar viele Reichstagsabgeordnete einem Lippenbekenntnis zur Weimarer Reichsverfassung verweigerten, karikiert worden, so erlebten sie in der Bundesrepublik eine wahrhaft triumphale Wiederkehr. Unterstützt vom Schlagwort des "Verfassungspatriotismus", das der Konzeption philosophische Legitimität verlieh, ist die Idee, daß die Verfassung (und damit die diese schützende Verfassungsgerichtsbarkeit) einheits-, identitäts- und insgesamt integrationsstiftend wirke, aus der rechts- und politikwissenschaftlichen Diskussion nicht mehr fortzudenken. Sehen wir mit Roland Barthes das Wesen eines Mythos darin, einer historisch bedingten Intention eine natürliche Rechtfertigung zu geben und damit etwas Kontingentes unendlich erscheinen zu lassen[ 6], so hat der Gedanke der Integration durch Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit ohne weiteres das Zeug zum Mythos. Nun ist aber das Phänomen des Mythos selbst kontingent, vor allem in bezug auf seine Zeitunterworfenheit. Mythen entstehen und gehen wieder. Der Mythos von der Integration durch die Verfassungsgerichtsbarkeit wird zwar weiterhin aufrechterhalten[ 7]; jedoch, so die hier vertretene These, handelt es sich um einen Mythos, dessen Zeit gekommen ist. Die scharfen Angriffe auf das Bundesverfassungsgericht werden als Anzeichen dafür gesehen, daß der Mythos funktionsunfähig geworden ist und die "Vertextung des Staates ihr Ende erreicht" hat.[ 8] Um dies nachzuweisen, werden zunächst die Stellung des Staates sowie das Menschenbild im Pluralismus allgemein und im spezifisch deutschen Neo-Pluralismus im besonderen nachgezeichnet. Hierbei wird auch auf die besondere Frontstellung von Staat und Gesellschaft eingegangen werden (I. und II.). Die Idee eines "underlying consensus" oder eines "consensus omnium" wird als eine der zentralen Schwachstellen des Pluralismus identifiziert (III.). Anschließend werden exemplarisch verschiedene Möglichkeiten einer inhaltlichen Unterfütterung jenes Konsenses angesprochen und verworfen (IV.). Die Rhetorisierung von Konsens und ihre Gefahren werden am Beispiel der politischen Parteien verdeutlicht (V.), um anschließend die Folgen der gesellschaftlichen Pluralisierung für den Staat, im einzelnen für Parlament und Regierung (VI.) und insbesondere das Bundesverfassungsgericht zu analysieren; in bezug auf letzteres wird das Augenmerk auf die nachlassende integrative Leistungskraft des Wertediskurses der Verfassung und des Rechtsdiskurses gerichtet. Ebenso werden gesellschaftliche Tendenzen in die Populismus/Progressivismus-Unterscheidung eingeordnet und damit ein zusätzlicher Faktor für die gegenwärtige Entwicklung lokalisiert (VII.). Nicht nur die zu kurz greifende Kritik am Bundesverfassungsgericht, so wird sich anschließend zeigen, sondern auch anspruchsvolle "pluralistische" Theorien der Verfassungsgerichtsbarkeit werden dieser Diagnose nicht gerecht (VIII.). Das Ergebnis ermutigt dazu, andere Richtungen einzuschlagen (IX.).
Das politische System der Bundesrepublik ist das einer pluralistischen Demokratie. Dies allein besitzt jedoch nur wenig Aussagekraft, existieren doch viele Ausprägungen von Pluralismus: Winfried Brugger spricht vom "starken Pluralismus von Pluralismuskonzeptionen".[ 9] Gemeinsam ist ihnen, daß sie die von Madison eloquent beschriebene unvermeidliche Gruppenbildung anerkennen und ins Positive wenden.[ 10] Factionalism und Vielgliedrigkeit von Gruppen werden als Basis der Demokratie konzipiert und zugleich als Wendung gegen Etatismus, Liberalismus und Totalitarismus.[ 11] Der klassische Pluralismus, von dem Franz Lehner meinte, er sei "im Grunde genommen ein Versuch, das dem Markt zugrunde liegende Konzept einer spontanen Ordnung auf das politische System zu übertragen"[12], nahm noch an, daß die folgenden Annahmen zuträfen: eine legitime Interessenvielfalt; Gemeinwohl als regulative Idee; ein notwendiges Spannungsverhältnis von Konsens und Konflikt (mit der Vorstellung eines zugrundeliegenden Minimalkonsenses); und Konkurrenz als Methode der Interessenaggregation. Ebenso bekannt wie unbestreitbar sind auch die Einwände hiergegen: gesellschaftliche Interessen sind weder gleich konflikt- noch organisationsfähig. Gerade gemeinwohlbetreffende Interessen sind häufig diffus und daher benachteiligt. Die Fragmentierung der Macht garantiert auch keineswegs, daß der Staat allen Gruppen in gleicher Weise Zugang gewährt, daß er außerdem nicht nur mit ihnen kommuniziert, sondern in bezug auf die diskutierten Themen auch aktiv die Initiative ergreift, oder daß er sich auch von anderen Gruppen beeinflussen läßt als von denjenigen, die eine starke Position oder einen privilegierten Zugang besitzen. Insbesondere Wirtschaftsinteressen haben gute Chancen auf Bevorzugung. Weiterhin wird kritisiert, daß weder von erhöhter Legitimität noch von gesteigerter Rationalität ausgegangen werden könne. Insgesamt seien die Annahmen des klassischen Pluralismus ausgesprochen naiv gewesen [13], was darauf zurückgeführt wird, daß Theorie und Realität auseinanderklafften und daß deskriptive Analyse mit praeskriptiver Normativität eine unglückliche Mischung eingegangen sei. Der (amerikanische) Neo-Pluralismus zog hieraus die Konsequenzen: Robert Dahl, der zu den eloquentesten Befürwortern des klassischen Pluralismus gehört hatte[ 14], forderte, die Macht der Unternehmen stark einzuschränken; bis dies geschehen sei, könne man die Interessengruppen nicht als notwendigerweise gleich betrachten, und der Staat könne nicht in die Rolle eines neutralen Schiedsrichters schlüpfen.[ 15]
Der deutsche Neo-Pluralismus, seit etwa Ende der 50er Jahre vor allem durch Ernst Fraenkel beeinflußt, wird noch deutlicher. Auch er realisiert, daß Machtpositionen und Einflußmöglichkeiten unterschiedlich verteilt sind, hat einen Blick auf die "sozio-ökonomische Realität" und will die "Ungleichheit der sozialen Startposition eliminieren". Mit anderen Worten: der Herrschaftsanspruch des Staates wird alles andere als aufgegeben. Vielmehr visiert Fraenkel selbst den interventionistischen Staat an, von dem Alexander von Brünneck meint, daß die Große Koalition von 1966 ihn auf den Plan gebracht und damit zur schwindenen Aktualität des Fraenkelschen Neo-Pluralismus beigetragen habe.[ 16] Unter der Überschrift "Der soziale Rechtsstaat" schreibt Fraenkel:
"Hieraus [aus der sozio-ökonomischen Realität] ergibt sich aber für den Staat die Notwendigkeit, dem übermäßigen Einfluß oligopolistischer, wenn nicht gar monopolistischer Träger sozio-ökonomischer Macht entgegenzutreten. Nicht minder bedeutsam ist es für den Staat, dafür Sorge zu tragen, daß der Einfluß all der Bevölkerungskreise nicht zu kurz kommt, die außerstande sind, zwecks Wahrung ihrer Interessen ausreichend machtvolle Verbände zu bilden und funktionsfähig zu erhalten. ... Im Gegensatz zu dem Rechtsstaatsdenken der Vergangenheit, das sich damit begnügte, einen Rechtsschutz gegen bereits erfolgte Beeinträchtigungen der individuellen Freiheitssphäre zu gewähren, setzt sich das Rechtsstaatsdenken der Gegenwart die zusätzliche Aufgabe, prophylaktisch die Entstehung politischer, wirtschaftlicher und insbesondere sozialer Bedingungen zu verhüten, aus denen eine Gefährdung rechtsstaatlicher Prinzipien zu erwachsen vermag."[ 17]
In der Tat findet sich beim Begründer der deutschen (Neo-) Pluralismustheorie ein Gutteil Gedankengut jener Richtung, die im Anschluß an amerikanische Kategorisierungen "liberal" genannt wird. Selbstverständlich werden Kernaussagen des (klassischen) Pluralismus übernommen, etwa diejenige, daß Interessen durch das Medium der Konkurrenz aggregiert werden. Zugleich werden die utilitaristischen Fundamente des Pluralismus mitgeschleppt -- jedoch lassen sich bereits hier unterschiedliche Nuancen festmachen. Konzentrierte sich der klassische Pluralismus noch auf das, was ich "Gruppen-Utilitarismus" nennen möchte, also die Existenz von Präferenzen, die im Eigeninteresse der jeweiligen Gruppe liegen, so geht der Neo-Pluralismus einen analytischen Schritt weiter und fokussiert auf das hinter der Gruppe stehende Individuum. Der einzelne spielt im klassischen Pluralismus so gut wie keine Rolle. Symptomatisch etwa ist die Meinung Seymour Martin Lipsets, der meinte, daß mangelnde Partizipation der Bürger ein Zeichen für eine gesunde (weil zufriedene) Demokratie sei.[18] Demgegenüber begibt sich der Neo-Pluralismus -- über die deskriptive policy analysis weit hinaus -- in den Bereich der Anthropologie, wenn er sich der Auffassung anschließt, daß "die Verfolgung von Eigeninteressen einen essentiellen Bestandteil der menschlichen Natur bildet".[ 19] Genau an dieser Stelle löst sich ein typisches Wesensmerkmal der Pluralismustheorie auf. Dieses Charakteristikum, das durch diese verschobene Perspektive preisgegeben wird, wird von Manfred Schmidt so formuliert:
"Pluralismustheoretiker grenzen sich von verschiedenen konkurrierenden Strömungen ab, nicht nur von der klassisch-liberalen Theorie, insbesondere der gedanklich konstruierten Entgegensetzung von Staat und einer Gesellschaft, die aus atomisierten Individuen zusammengesetzt gedacht wird. Die Pluralisten betonen demgegenüber die Vielgliedrigkeit von Staat und Gesellschaft und der intermediären -- zwischen Staat und Gesellschaft vermittelnden -- Institutionen."[ 20]
Die unterschiedliche Brennweite zerstört vor allem die Grenzziehung zwischen Pluralismus und Liberalismus. Fatal ist dabei vor allem die Gleichsetzung von ("radikalem"[ 21]) Pluralismus mit klassischem Liberalismus oder, genauer, der Variante, die Amerikaner als (konservativen) libertarianism bezeichnen. Daß hierdurch z.T. eine verkehrte Welt entsteht, zeigt der Beitrag Bruggers, der seiner (allerdings als "idealtypisches Konstrukt" bezeichneten) radikalen Pluralismusversion sämtliche Attribute mitgibt, die die antiliberalistische Kritik (darunter Carl Schmitt, Roberto Unger, sowie nunmehr auch die lange Reihe kommunitaristischer Kommentatoren) vorgebracht hat, insbesondere "Atomismus".[ 22] Dies muß den erstaunen, der um den Fokus des klassischen Pluralismus auf Gruppen -- mithin auf den Menschen in notwendiger, nicht nur nebensächlicher Assoziierung -- weiß.
Mag diese Differenzierung zunächst nebensächlich oder theoretisch wirken, so hat sie doch sehr praktische Auswirkungen. Im klassischen Pluralismus ist das Gemeinwohl als "Metapher für die Resultante im Kräfteparallelogramm der Gruppen" bzw. als "Pluriversum der zum Kompromiß gekommenen, ausbalancierten Interessen" konzipiert.[23] Dabei gibt es kein Zentrum der Letztentscheidung, wie David Held feststellt: "There is no ultimately powerful decision-making center in the classic pluralist model. ... [P]ower is effectively disaggregated and non-cumulative; it is shared and bartered by numerous groups in society representing diverse interests".[24] Der (deutsche) Neo-Pluralismus hingegen zieht aus der Übertragung des "Gruppen-Utilitarismus" auf das Individuum die Konsequenz, daß es eines gemeinwohlorientierten Entscheidungszentrums bedürfe: des läuternden, filternden und managenden Staates. Man vergleiche etwa Ernst Fraenkels Worte mit dem gerade referierten Zitat von Klaus von Beyme:
"[Das Gemeinwohl stellt sich als] Resultante dar, die sich jeweils aus dem Parallelogramm der ökonomischen, sozialen, politischen und ideologischen Kräfte einer Nation dann ergibt, wenn ein Ausgleich angestrebt und erreicht wird, der objektiv den Mindestanforderungen einer gerechten Sozialordnung entspricht und subjektiv von keiner maßgeblichen Gruppe als Vergewaltigung empfunden wird."[25]
Der Staat wird mithin zum Verwalter und Aufseher über Fraenkels consensus omnium, der wiederum fundiert ist in der "Geltung eines Naturrechts" und den "Geboten der sozialen Ethik"; beide sollen "die Mindesterfordernisse der sozialen Gerechtigkeit" garantieren.[26] In dieser Variante verliert der Pluralismus seine "anti-etatistische" Stoßrichtung und zielt stattdessen auf das genaue Gegenteil. Dadurch vermählt er sich auch wieder mit dem, was Kurt Sontheimer die "etatistische Tradition" Deutschlands nennt: "In Deutschland galt der Staat immer besonders viel."[27] Hans Lietzmann spricht von der "Renaissance der Staatsorientierung in Deutschland"[28], und die politische Wissenschaft läßt sich an dieser Stelle mit typischem Theorie-understatement, aber dennoch vielsagend in den Worten von Beymes zitieren: "Theoretiker von Proporz- und Konkordanzdemokratie konnten leicht eine istrukturelle Isomorphiei der bisher erforschten Konkordanzdemokratie mit dem iliberalen Korporatismusi entdecken, mit der Neigung, hochintegrierte und relativ elitäre Gruppen zur Aushandlung von Konflikten antreten zu lassen, die sich nicht majoritär schlichten ließen..."[29]
Die deutsche Staatslehre (die im Unterschied etwa zum anglo-amerikanischen Raum eben Staats- und nicht Verfassungslehre heißt) und Staatspraxis haben ihre Konsequenzen zur Genüge gezogen. Ihr Ausgangspunkt ist liberaler Individualismus (der nicht notwendigerweise gleichzusetzen ist mit Atomismus) -- der einzelne wird einerseits als Fundament, Ziel- und Zweckbestimmung des Gemeinwesens begriffen, das sich um Art. 1 Abs. 1 S. 1 GG herum organisiert ("Die Würde des Menschen ist unantastbar."). Andererseits aber steht die Notwendigkeit der egoistischen Zielverfolgung durch den Menschen im Raum. Durch dieses Spannungsverhältnis läßt sich eine Ideologie erklären, die Benjamin Barber als "political zookeeping" umschreibt. Das Menschenbild charakterisiert er folgendermaßen: "Like captured leopards, men are to be admired for their proud individuality and for their unshackled freedom, but they must be caged for their untrustworthiness and antisocial orneriness all the same."[30] Ein solches Menschenbild kann nicht ohne Auswirkungen auf die Organisation des politischen Prozesses bleiben. Viele Egoisten zusammengenommen ergeben noch keine altruistische Gemeinschaft. Aus diesem Grund muß der Demos, dem ebenso wie dem Individuum Respekt zu zollen ist (vgl. Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG: "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus."), mit Vorsicht behandelt werden. Treffend schlußfolgert wiederum Barber: "Indeed, if the individual is dangerous, the species is deadly. Liberal democracyis sturdiest cages are reserved for the People."[31] Damit sind die beiden Antipoden des Gemeinwesens definiert: Die gerade beschriebene Gesellschaft auf der einen Seite; der läuternde, tugendhafte, gemeinwohlorientierte Staat auf der anderen Seite.
Die deutsche Lesart des Neo-Pluralismus interpretiert die deutsche Geschichte und ihre Lehren (in Theorie und Praxis) auf ihre Art. In praktischer Hinsicht wurde aus den Erfahrungen der Weimarer Republik und dem nationalsozialistischen Regime die Konsequenz gezogen, daß das deutsche Volk für autoritäre Dispositionen anfällig und noch nicht ohne weiteres demokratiefähig war.[32] Der Pluralismus, der in der normativen Ausprägung seiner klassischen Version eigentlich angetreten war, um den gesellschaftlichen Interessengruppen gegenüber dem Staat zu mehr Legitimationsfunktion und Macht zu verhelfen und diese mit dem Staat sogar auf eine Verhandlungsebene hob, konnte nunmehr als theoretische Fundierung jener praktischen Lehre dienen. In theoretischer Hinsicht konnte ebenfalls an die deutsche Geschichte angeknüpft werden. Bereits Hegel hatte geschrieben: "In der bürgerlichen Gesellschaft ist jeder sich Zweck, alles andere ist ihm nichts. Aber ohne Beziehung auf andere kann er den Umfang seiner Zwecke nicht erreichen; diese anderen sind daher Mittel zum Zweck des Besonderen."[33] Die entzweite Gesellschaft mit all ihren Gegensätzlichkeiten, ihrem Willkürcharakter und ihren Partikularinteressen wird -- nach Hegel -- durch den über ihr stehenden Staat versöhnt. Dieser ist eine Erscheinungsform des objektiven Vernunftprozesses: Der Staat als "die Wirklichkeit der sittlichen Idee"[34] überwindet die in der Gesellschaft unlösbar gewordenen Widersprüche und bändigt die auflösende Dynamik der Gesellschaft. Dementsprechend steht Hegel den Konzepten der Volkssouveränität und demokratischer Beteiligungsrechte skeptisch gegenüber: Allein in der Vernunft des Staates wird historisch mögliche Freiheit realisiert, denn "der Staat ist die Wirklichkeit der konkreten Freiheit"[35].
An dieser Stelle kann zu Recht eingewandt werden, daß das politische und Rechtssystem der Bundesrepublik gerade nach den nationalsozialistischen Erfahrungen gegen mögliche Übergriffe des Staates auf die Freiheitssphäre des Individuums konstruiert wurde. Freiheit wird gerade nicht mehr als ausschließlich im und durch den Staat realisiert begriffen. Dies wird hier nicht bestritten (auch wenn als Fußnote angefügt werden soll, daß der bürgerlich-liberale Freiheitsbegriff abgelöst worden ist durch die Erkenntnis, daß die reale Ermöglichung und Sicherung der Freiheit dem Staat mittels sozialer Leistungen und Gewährleistungen obliegt).[36] Worauf es im vorliegenden Zusammenhang jedoch ankommt -- und allein dies ist der Sinn der gleichzeitigen Heranziehung Hegels und der Lehren aus der Weimarer und nationalsozialistischen Zeit --, ist die Gegenüberstellung einer weitgehend durch Utilitarismus und Egoismus geprägten Gesellschaft (jedenfalls einer Gesellschaft, der man im Hinblick auf den politischen Prozeß nicht trauen kann, stehe nun das Gemeinwohl [Utilitarismus] oder die Demokratie [autoritäre Disposition des deutschen Demos] im Vordergrund) und eines tugendhaften, deliberativen und weisen Staates, der die popularen Energien filtert, managed und läutert.
Eine solche Konstruktion, die im Grundgesetz und in der wohl herrschenden deutschen Staatslehre eine Stütze findet, wirft die Frage auf, die man wohl als das große schwarze Loch jeglicher Demokratietheorie bezeichnen kann, nämlich danach, was nun genau eine Gesellschaft integriert. Hierbei geht es um weit mehr als nur darum, Ordnung herzustellen oder zu erhalten. Es geht etwa auch darum, warum man sich dem Mehrheitsprinzip unterwirft (und sich damit abfindet, daß die eigene Meinung auf unabsehbare Zeit in der Minderheit bleiben wird); warum man Entscheidungen als für sich verbindlich akzeptiert, die im krassen Gegensatz zur eigenen Überzeugung stehen; warum man sich anderen gegenüber quasi unhinterfragbar in die Pflicht nehmen läßt (etwa im Wege der Steuer). Darüber hinaus geht es weiterhin um Fragen der kollektiven und individuellen Identität. Was macht mich zum Deutschen, Franzosen, Briten; aber auch zum Schotten einerseits, und zum Europäer andererseits? Dies sind die Fragen, die im Kern einer substantiellen Konzeption des Demos liegen. Sie sind durch eine Vielzahl von Doppelungen gekennzeichent: Sie sind sowohl materieller als auch prozeduraler Natur; sowohl kollektiv als auch individuell; sowohl öffentlich als auch privat; sowohl nach außen (abgrenzend) als auch nach innen (identifikatorisch) greifend. Sie liegen im Schnittpunkt einer Vielzahl wissenschaftlicher Disziplinen, darunter Soziologie, Recht, Politikwissenschaft, Anthropologie, Psychologie. Antworten sind wie Sand am Meer, und sie wurzeln in so unterschiedlichen Phänomenen wie Kultur, Religion, Sprache, politischem Diskurs, Ethnizität, dem Gefühl, "zu Hause zu sein", oder dem Einigsein über ein paar gemeinsame prozedurale Spielregeln. Es geht um eine Legitimation von Autorität, die die verfassungspositive Antwort -- "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus" -- insofern transzendiert, als "das Volk" in Frage steht. Es wäre insoweit ein "strange loop" im Sinne von Douglas Hofstadter und Günther Teubner, auf das die Staatsangehörigkeit regelnde Recht zu verweisen.[37] Nicht umsonst führte das Bundesverfassungsgericht im Maastricht-Urteil aus: "Demokratie, soll sie nicht lediglich formales Zurechnungsprinzip bleiben, ist vom Vorhandensein bestimmter vorrechtlicher Voraussetzungen abhängig...".[38]
Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen hatten, haben eine zuweilen heftige und über die Grenzen Deutschlands hinausgehende Diskussion über eben jene vorrechtlichen Bedingungen ausgelöst.[39] Lassen wir den Vorwurf einmal außer acht, das Gericht stütze sich auf einen ethnisch grundierten Volksbegriff[40], so sehen wir sein Bemühen, den Demos zumindest auch im Hinblick auf die Theorie des Pluralismus zu definieren. So erwähnt das Gericht als vorrechtliche Voraussetzung "eine[] ständige[] freie[] Auseinanderstzung zwischen sich begegnenden sozialen Kräften, Interessen und Ideen, in der sich auch politische Ziele klären und wandeln [...] und aus der heraus eine öffentliche Meinung den politischen Willen vorformt."[41] Hieran muß sich die Frage anschließen: Besitzt der Pluralismus tatsächlich eine solche integrierende Kraft?
Gerade die pluralistische Theorie muß sich fragen und fragen lassen, wie die Gesellschaft zusammengehalten wird. Den klassischen Pluralismus schien dies wenig zu kümmern; der Neo-Pluralismus aber war sich der an und für sich überraschenden Tatsache bewußt, daß Gemeinwesen, die (in der klassischen Pluralismusversion) durch antagonistisch-konkurrierende Interessen gekennzeichnet waren, überhaupt eine stabile Einheit bildeten. Des Rätsels Lösung schien in der Idee des Konsens zu liegen. Robert Dahl sprach von einem "underlying consensus":
"In a sense, what we ordinarily describe as democratic ipoliticsi is merely a chaff. It is the surface manifestation, representing superficial conflicts. Prior to politics, beneath it, enveloping it, restricting it, conditioning it, is the underlying consensus on policy that usually exists in the society among a predominant portion of the politically active members."[42]
Ernst Fraenkel, wie gesehen, konstruiert einen consensus omnium innerhalb eines "nicht-kontroversen Sektors". Dieser sei ein unerläßliches "Minimum allgemeingültiger Prinzipien", die mit der "Geltung eines Naturrechts" und einem "abstrakten Wertkodex" identifiziert werden.[43] Jedoch sind sich die Pluralismustheoretiker selbst nicht sicher, was dies denn nun genau heißen soll. Dahl meint, der Konsens beziehe sich auf dreierlei: Verfahrensregeln, das Ausmaß politischer Optionen und die legitime Reichweite politischen Handelns. Damit aber sind uns konkrete Maßstäbe noch nicht an die Hand gegeben. Fraenkel schreibt, daß die "Konkretisierung [des abstrakten Wertkodex] stets und von neuem durch Anpassung an die einem ständigen Wandel unterzogenen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Gegebenheiten zu erfolgen hat".[44] Winfried Brugger schließlich gibt in offener Kapitulation zu: "Wieviel genau an Konsens und Dissens in welchen Bereichen zur Aufrechterhaltung einer funktionierenden Ordnung notwendig ist, vermag der geläuterte Pluralismus über einige grundsätzliche Erwägungen hinaus nicht zu sagen -- das bedarf näherer Untersuchung."[45]
Wir wollen eine nähere Untersuchung wagen, allerdings nicht in dem Sinne, daß am Ende der Ausführungen die Nation, die Verfassung oder eben die Verfassungsgerichtsbarkeit als deus ex machina für die Integration der modernen Gesellschaft steht. Vielmehr wird gezeigt werden, wie sehr sich der nicht-kontroverse gesellschaftliche Konsens seinerseits als nur schwaches oder gar zweifelhaftes Legitimationsmuster eignet. Der Staat, der sich selbst die Aufgabe aufbürdet, den "Konsens" entweder herzustellen, zumindest aber zu artikulieren, wird sich als überfordert zeigen. Dies gilt auch für die Spitze der läuternden Hierarchie, das Bundesverfassungsgericht. Wo die großen legitimierenden Erzählungen am Ende sind, so wird erhellen, kann das Bundesverfassungsgericht nicht als Substitut herhalten, auch wenn es dies selbst annimmt. Die Diskussion um die Kruzifix-Entscheidung dürfte den Karlsruher Richtern und Richterinnen die ersten Zweifel beigebracht haben. Auch die Kritiker des Gerichts jedoch werden lernen müssen, daß Angriffe gegen das Verfassungsgericht wegen angeblich fehlender Integrationskraft zu kurz gegriffen und wenig konstruktiv sind.
Nach dem bisher über das Gesellschaftsbild des Pluralismus -- welcher Couleur auch immer -- Gesagten muß es fast schon befremdlich anmuten zu erwarten, daß die nicht durch den Staat mediatisierte Gesellschaft einen Konsens artikulieren könnte, oder gar einen Konsens, der nicht auf egoistische Zwecke ausgerichtet ist. Jedoch ergibt es sich in der von Fraenkel anvisierten Konzeption des Rechtsstaates, daß der Staat als Sprachrohr der Gesellschaft auftritt. (Auf die politischen Parteien wird später zurückzukommen sein.) Nun existieren im Grundsatz zwei Möglichkeiten: Entweder der Staat integriert die Gesellschaft (dies wäre wohl in Hegels Sinne), oder der Staat formuliert nur die gesellschaftliche Integration. So lohnend eine Weiterverfolgung dieser wichtigen Unterscheidung wäre -- im hiesigen Zusammenhang kann dies dahinstehen, denn es macht für das vorliegende Problem keinen Unterschied, ob der Staat referiert oder konstruiert. Worauf es hier ankommt sind die Symbole, mit Hilfe derer dies geschieht.
Wir können zwischen zwei verschiedenen Arten der Integration unterscheiden; die eine soll heteronome, die andere autonome Integration genannt werden. Unter heteronomer Integration wird der Sachverhalt verstanden werden, daß sich eine Gesellschaft primär in Abgrenzung zu etwas integriert; es werden Grenzen gezogen, die deutlich machen, daß hier ein Unterschied besteht; dieser wiederum verleiht der umgrenzten Gesellschaft Einheit. Jene allerdings wurzelt nicht so sehr in einem aus innen gewachsenen Konsens, sondern in der negatorisch-kontrastiven Aus- und Abgrenzung.[46] Im Gegensatz zu autonomer Integration hat die heteronome den "Vorteil", Konsens zu erzeugen, wo keiner besteht, und sogar von Demokratie freizusetzen. Ulrich Beck formuliert dies so:
"Da in allen Demokratien Konsens zu einer chronisch knappen Ressource geworden ist, kann man sagen, daß demokratische Staaten auf die nebendemokratische Zweitquelle - Feindbild -, aus der Zustimmung sprudelt, in besonderem Maße angewiesen sind. Feindbilder, innenpolitisch gewendet, bilden, enthalten, eröffnen Quellen außerdemokratischer, gegendemokratischer, antidemokratischer Zustimmung. Ihre Pflege ermöglicht, mit Konsens vom Konsens unabhängig zu werden. Feindbilder stellen sozusagen alternative Energiequellen für den mit der Entfaltung der Demokratie aufgebrauchten Rohstoff Konsens dar. Die innere Demokratisierung einer Gesellschaft kann durch Feindbilder in Schach gehalten werden, ohne auf Zustimmung verzichten zu müssen. Feindbilder - von ihrer Innenseite, ihren innenpolitischen Hauptnebenfolgen her betrachtet - ermöglichen die Freisetzung von Demokratie mit dem Segen der Demokratie."[47]
Die Nachkriegszeit kannte in der Bundesrepublik den nachfaschistischen und den antikommunistischen Konsens.[48] Seit 1989 ist es fast schon ein Allgemeinplatz geworden, darauf hinzuweisen, daß beide Bedrohungen fortgefallen sind und somit beide Feindbilder keinen Konsens mehr generieren können.[49] Dies mag man bedauern oder, wie Beck, differenzierter sehen und auf die demokratiebegrenzenden oder -verdünnten Räume hinweisen, die durch heteronome Integration ermöglicht werden.[50] Die Chance, die der Kollaps von Faschismus und nun Kommunismus für die westlichen Demokratien mit sich gebracht hat, besteht in der Möglichkeit der Selbstbesinnung. Die Gefahr besteht in der Suche nach anderweitiger heterogener Konsenserzeugung. Als solche kommt insbesondere die Konstruktion des Fremden als Feindbild in Betracht: Es sei daran erinnert, daß mit dem Fall der Grenzen 1989 zugleich auch eine Welle Fremdenhaß durch Deutschland brandete.[51] Zu hoffen ist jedoch, daß sich eine Gesellschaft heute nicht mehr durch Fremdenhaß integrieren läßt; und selbst sollte diese "Option" noch bestehen, so ist ihr -- auch das ist selbstverständlich -- entgegenzuwirken.
Autonome Integration konzentriert sich auf das Wesen der eigenen Gemeinschaft, anstatt das Heil in der Abgrenzung vom Anderen zu suchen. Im Gegensatz zur heteronomen Integration, die immer einen gefahrvollen Kern von Konfliktpotential (nach außen) und Ermächtigung (nach innen) in sich birgt, zeichnet sich autonome Integration zumeist durch weniger aggressive, langsamere, deliberativere und schwerer zu erringende Konsensbildung aus (was allerdings nicht heißen muß, daß nicht auch letztendlich Konflikt anvisiert wird: dies ist eine inhärente Gefahr jeglicher Konzeptionalisierung von Gemeinschaft, vor allem unter dem Homogenitäts-Paradigma -- Konsens bedeutet zugleich immer auch Ausschluß anderer Möglichkeiten; Einheit bedeutet immer auch zugleich Exklusion von anderen). Im folgenden sollen drei verschiedene Wege der autonomen Integration unterschieden werden, die sich gewissermaßen auf einem Zeitstrahl anordnen lassen. Der erste ist zukunftszugewandt und schwört eine Gemeinschaft auf bestimmte Ziele ein. Konsens wird in bezug auf (in der Zukunft erreichbare) Ideale konstruiert, weshalb hier der label "Telos" verwandt werden wird. Der zweite rückt hiervon ab und beschränkt sich auf das Heute. Dies ist in der Tat anspruchsvoll genug, denn eine Gemeinschaft unter einem bestimmten Modus des Miteinander-Umgehens zu versammeln ist gewiß keine leichte Aufgabe. Das Jetzt steht im Mittelpunkt, operationalisiert durch die Frage, unter Zugrundelegung welcher Maßstäbe wie gehandelt werden soll. Ich werde diese Integrationsmethode als "Ethos" bezeichnen. Der dritte Weg autonomer Integration schließlich blickt primär in die Vergangenheit und beruft sich auf die gemeinsamen Wurzeln einer gegebenen Gemeinschaft. Sinn- und einheitsstiftend wirkt insoweit die "Historia".
Joseph Weiler meint, daß der Diskurs unter Bezugnahme auf "Ideale", ähnlich wie auf Religion und Spiritualität, im 20. Jahrhundert ein schon fast peinliches Thema ist.[52] Dies allerdings berücksichtigt nur die Diskursoberfläche der versuchten Wertneutralisierung einerseits, der kritischen und postmodernen Theorie[53] andererseits. Es bedarf weder Anstrengung noch Phantasie, nach großen Zusammenbrüchen, in Zeiten des Aufbruchs, der Hoffnung und des Fortschritts Ideale zu suchen und zu finden. Allein die Grenzziehung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, das "Lernen aus dem Gestern", stellt Visionen zur Verfügung. Die Abgrenzung etwa vom Totalitarismus allein besorgt ein hoffnungsvolles sich Sammeln unter dem Schirm von Freiheit und Demokratie. Die Unmittelbarkeit des gerade erst Gewesenen vermittelt einen Gegensatz, der Nähe zur heteronomen Integration aufweist; der Unterschied ist allein, daß das ausgegrenzte Andere in diesem Fall die eigene Vergangenheit, gewissermaßen ein abhorrendes Ich ist. Dieser Mechanismus funktioniert nicht mehr, wenn einmal das Abgrenzungsobjekt verblaßt ist. Wie viel komplizierter ist es, in einer realen Demokratie über Demokratie zu reden, als in einer Diktatur! Auch die treibende Kraft des Aufbruchs, die emotionale, hoffnungsgeladene Stimmung, weicht früher oder später dem grauen Alltag des demokratischen Tagesgeschäfts. Es ist insofern nicht "peinlich", über Ideale zu sprechen -- es ist einfach viel schwieriger.[54] Manche Ideale erledigen sich von selbst. Frieden etwa wurde in Europa erreicht. Seine Thematisierung heute beschränkt sich, wie Weiler bemerkt, auf den "Frieden von München, ... der vor 50 Jahren die Zergliederung der Tschechoslowakei gesehen hat und heute die Zerstörung Bosniens erlebt".[55] In diesem Rahmen wirkt seine Thematisierung sogar destabilisierend: Einte etwa gestern noch die Überzeugung von der Tugend totaler Gewaltlosigkeit und Pazifismusi das "grüne" oder "linke" Lager, so ist auch dieser Konsens nunmehr zerbrochen. Nicht anders geht es "wirtschaftlichen" Idealen, seien sie nun positiv (Wohlstand) oder negativ (Kampf gegen Arbeitslosigkeit) formuliert. Sollte man auf den ersten Blick davon ausgehen können, daß uns zumindest hier ein gemeinsames Ziel eint, so stellt sich aus verschiedenen Gründen heraus, daß dies kein Fundament ist, auf dem ein Gemeinwesen aufbauen sollte. Zum einen fehlt dem Streben von (relativem) Wohlstand zu noch mehr Wohlstand das tugendhafte, idyllische Element, das Ideale auszeichnet. Zum anderen reflektiert gerade das wirtschaftliche Streben die Individualisierung (nicht als Emanzipation gedacht, sondern als Freisetzung, d.h. als Herauslösung aus geschichtlich vorgegebenen Sozialformen und -bindungen) der Moderne.[56] Und schließlich trägt auch die allgemeine Verschiebung von "Schicksal" hin zu Begriffen von Risiko und Gefahr (mit der Option der Versicherbarkeit)[57] dazu bei, eine Kalkultions- und Beeinflußbarkeitsvermutung auszusprechen, die etwa Arbeitslosigkeit zusätzlich in die Sphäre des Individuellen rückt. Nein, wirtschaftliche Ideale (ebensowenig wie wirtschaftliche "Feindbilder" wie die Arbeitslosigkeit) taugen heute nicht für demokratischen Konsens oder die Konzeptionalisierung von Gemeinschaft.
Erleben wir, im Gegensatz dazu, gegenwärtig die Entfaltung eines neuen konsens-, sinn- und strukturbildenden Paradigmas in Gestalt der Ökologie? Sind die Umwelt und ihr Schutz das Ideal des ausgehenden 20. Jahrhunderts, das Volk und Völker eint? Der eindrucksvoll einmütige Boykott von Shell durch deutsche Autofahrer im Zusammenhang mit der Entsorgung der "Brent Spar" Bohrinsel diesseits des Atlantiks, und die "Wege zum Gleichgewicht" des US-amerikanischen Vize-Präsidenten Al Gore[58] auf der anderen Seite scheinen in diese Richtung zu weisen. Möglicherweise liegt hier in der Tat eine Chance. Doch ebenso ist Vorsicht angebracht. Zum einen ist die Aussicht auf einen "globalen ökologischen Konsens"[59] gering, denn es gilt nicht zu vergessen, daß die integrierende ökologische Moral diejenige der westlichen Verbrauchernationen ist. Zum zweiten birgt auch ökologische Kommunikation diktatorisches Potential in sich, etwa in Gestalt der Unentrinnbarkeit.[60] Und schließlich darf auch die strukturstiftende Kraft der Umwelt nicht überschätzt werden, wird es der Ökologie doch schwerfallen, in bezug auf viele Bereiche Anwendungsdiskurse zu ermöglichen. Insgesamt scheint es doch so, wie uns Jean-François Lyotards Memorandum über Legitimation belehrt: In einer Republik (die in diesem Zusammenhang als Abgrenzung gegenüber Despotismus und Totalitarismus verwandt wird) erleben wir per definitionem eine Unsicherheit über die Ziele -- und zugleich eine Unsicherheit über die Identität des Wir.[61]
Gehen wir einen Schritt zurück und konzentrieren uns, anstatt auf die Zukunft, auf das Heute und die Normen und Maßstäbe, die wir zur Regulierung des Miteinanders zugrundelegen wollen, so bietet sich nicht unbedingt ein einfacherers, viele würden sagen: erfreulicheres Bild. Wo teleologische Visionen scheitern, wird das Ethos um so wichtiger. Und doch dürfte es gerade dieser Bereich sein, den die moderne Sozialwissenschaft aufs Korn genommen hat. Dies darf nicht als Vorwurf mißverstanden werden: Gesellschaftlich-zentrifugale Tendenzen werden von der Wissenschaft nicht aus dem Nichts heraus konstruiert, sondern primär beobachtet und beschrieben. Wenn Luhmann von der funktionalen Ausdifferenzierung der Gesellschaft in Teilsysteme spricht, so hat das damit zu tun, daß die stratifikatorische Differenzierung der Gesellschaft in der Tat durch eine funktionale abgelöst worden ist, die sich in vielen mehr oder weniger autonomen (nach Luhmann: autopoietischen) Teilsystemen niederschlägt. Wenn Lyotard konstatiert, daß die großen Erzählungen ihre Glaubwürdigkeit verloren haben, ganz unabhängig davon, welcher Modus der Einheitsbildung benutzt wird und ob es sich um spekulative Erzählungen oder solche der Emanzipation handelt[62], dann mag das im einzelnen widerlegbar sein[63]; doch kann man Lyotard und der gesamten Postmoderne sicher nicht vorwerfen, ihr Projekt liege ganz neben der Sache. Es reflektiert die Orientierungslosigkeit und die Suche nach dem verlorenen Konsens, der unsere Moderne kennzeichnet.
In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf Weilers Diagnose des Europa am fin de siècle zurückgekommen. Er ordnet die frühen Ideale der Europäischen Gemeinschaften (Frieden, Wohlstand, Supranationalität) in "drei Grundströmungen des europäischen Idealismus" ein, der "dem zwanzigsten Jahrhundert innewohnt". Einer dieser "Grundwerte" sei das Christentum.[64] Es schließt sich notwendigerweise die Frage an, ob Religion gesellschaftlichen Konsens in modernen Demokratien stiften kann. Es sei darauf verzichtet, den Wandel der staatlichen Legitimation in seiner Emanzipation von der Religion nachzuzeichnen. Diese säkulare Umstellung der Legitimation, die die Politik zur Reflexion auf sich selbst zwingt, ist von anderen besser erklärt worden, als es mir gelingen könnte.[65] Für den Staat wird es also unmöglich, Legitimität aus der Religion zu schöpfen. Immerhin aber könnte sich die Gesellschaft unter den Vorzeichen der Religion sammeln. Auch hier jedoch bedarf es kaum langer Ausführungen; ein Hinweis auf das Klagelied der christlichen Großkirchen, die fortschreitenden Mitgliederschwund und leere Kirchen beklagen, sollte ausreichen, um die Idee eines christlichen Konsenses als irreal zu erkennen. Im Gegenteil: Die Thematisierung von Religion scheint eher zu Konflikt denn zu Einigung zu führen. Die kontroverse, emotionsgeladene und mit einem Hauch von existentieller Bedeutung angereicherte öffentliche Diskussion der Kruzifix-Entscheidung führte jedem Beobachter das Potential von Feindseligkeit bis hin zur Gewalt (in Gestalt von Bombendrohungen für das klagende Ehepaar) vor Augen. Diese Konsequenzen mögen Stephen Holmes vorgeschwebt haben, als er die Funktion der Verfassung u.a. darin sah, einzelne Themen aus der öffentlichen Diskussion freiwillig auszuschließen. Die Kodifizierung von bestimmten Problemkreisen als verfassungsmäßig garantierte Rechte -- etwa das Recht der Religionsfreiheit -- führe dazu, daß das jeweils betroffene Thema durch Verfassungsentscheid privatisiert und Demokratie dadurch erst funktionsfähig werde. Gerade religiöser Streit, wenn er sich in politischen Frontstellungen materialisiert, könne, so Holmes, die demokratische öffentliche Sphäre ganz zum Erliegen bringen.[66] Auch Dieter Grimm betont immer wieder diese Entlastungsfunktion der Verfassung.[67] Dies kann man entweder halb realistisch, halb resignierend hinnehmen; oder man kann entgegnen, daß dann Demokratie ja nur wirklich in Gang gesetzt wird, wenn nichts auf dem Spiel steht, und daß deshalb die Immunisierung kontroverser Themen von der öffentlichen Diskussion kaum eine demokratisch akzeptable Lösung ist.[68] Wie viele Beispiele zeigen, kann Demokratie gerade dann am besten funktionieren, wenn Fundamentalfragen für die öffentliche Diskussion geöffnet werden.[69] Wir müssen und können den Streit hier nicht entscheiden -- deutlich geworden ist jedenfalls, daß die Realität die Idee eines christlichen Konsenses in unserer Gesellschaft nicht trägt.[70]
Religion kann sich nicht vollständig von Moral emanzipieren. Ergibt sich etwa dann eine Lösung für unser sich abzeichnendes Integrations-Dilemma, wenn wir von der Transzendenz/Immanenz-Unterscheidung, die die Religion ausmacht, abstrahieren, um schließlich bei der Moral zu enden?[71] Zunächst scheint es so. Zum einen ist Integration durch Moral relativ leicht zu operationalisieren, handelt es sich doch bei Moral -- wie bei Recht auch -- um normativ formulierte Erwartungen.[72] Zum anderen ist Moral als Kommunikationssystem inklusiv (auch in bezug auf den im moralischen System Formulierenden, der an seine eigene Mitteilung gebunden ist); dagegen "gibt es keine Exklusion von Personen aus der Gesellschaft": "Die Moral kann also nicht über Inklusion/Exklusion entscheiden, sie kann nur die Inklusion schematisieren, und das ist die Funktion ihres Codes [der auf dem Hintergrund der Unterscheidung gut/böse oder gut/schlecht (oder Achtung/Mißachtung) operiert] ..."[73] Und doch, um es gleich zu sagen, sind die Aussichten auf eine moralische Integration der Gesellschaft denkbar schlecht. Dies hat verschiedene Gründe. Der erste, unmittelbar einsichtige, ist, daß zwar der Moralcode (als binärer Schematismus) gesellschaftsweit derselbe ist -- jedoch sind die Programme des moralischen Systems, also die "inhaltlichen" Kriterien, nach denen gut und böse voneinander unterschieden werden, alles andere als konsentiert oder auch nur konsensfähig.[74] Dies mag unzutreffend sein für ganz besondere, quasi aus dem Rahmen fallende Fälle; diese jedoch werden dann kaum einer ethischen Untersuchung unterzogen, sondern können effektiver im Rechtssystem akkommodiert werden.[75] Eine zweite Begründung für die Unmöglichkeit moralischer Integration liegt tiefer, gewissermaßen in der Struktur des moralischen Diskurses (oder abermals systemtheoretisch: in der Codierung des moralischen Systems). Formal kann man sagen: Die Unterscheidung, unter der moralische Kommunikation operiert, garantiert die Identität des moralischen Systems und kann nirgendwo anders als Leitentscheidung eines anderen Systems gebraucht werden. Inhaltlich bedeutet dies, daß andere Codes nicht auf den moralischen Code zugreifen und sich mit dessen Werten identifizieren dürfen. Dies nämlich hieße, daß die Regierung gut, die Opposition schlecht wäre (oder umgekehrt), oder daß der Eigentümer moralisch besser dastände als der Besitzlose (oder umgekehrt).[76] Ebenso hieße es, daß der Code des Rechts sich moralisch identifizieren würde: Rechtsgehorsam wäre gut, das Gegenteil böse. Nun kann wohl nicht behauptet werden, daß die Moral immer Rechtsgehorsam verlangt; manchmal ist genau das Gegenteil der Fall.[77] Auch übersehen Versuche, den Begriff des Rechts als denjenigen der Moral mitumfassend zu begreifen[78], daß damit eine moralische Kritik des Rechts verunmöglicht würde. Ingeborg Maus fügt dieser Kritik zu Recht an, daß eine moralische Begründung des Rechts in die "Sackgasse staatlicher Gerechtigkeitsexpertokratie" münden würde, da dann die "Endkontrolle" beim Staatsapparat, nicht aber der gesellschaftlichen Basis liegen würde.[79] Dies aber bedeutet nicht, daß die Gesellschaft dadurch einheitlichen moralischen Kriterien verpflichtet ist (oder auch nur sein sollte). Vielmehr gilt, daß eine Repräsentation der Gesellschaft als Ganzer in der Gesellschaft auch durch Moral nicht erreichbar ist.
Damit sind unsere Optionen normativen Erwartens aber noch nicht ausgeschöpft. Unter dem Begriff der "Werte" existiert ein Konzept, das quer zu den codemäßig festgelegten sozialen Funktionssystemen liegt. Werte sind offenbar unverzichtbar im heutigen gesellschaftlichen Diskurs, ob es sich nun um Parteiprogramme oder die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts handelt. Sie zeichnen sich dadurch aus, daß sie ohne Begründung gelten. Damit sind zwei Dinge gesagt: sie "gelten", womit sie sich vom rein faktischen Sein unterscheiden und als normativ ausgewiesen sind; und sie gelten "ohne Begründung", womit sie sich nach Luhmann zu einem "Reflexionsstop" eignen.[80] Liegt in diesen Eigenschaften die Lösung unseres Integrationsproblems? Zum einen scheinen sich normative Handlungsanweisungen[81] zu bieten, und zum anderen kann -- da es sich um "Höchstrelevanz" handelt[82] -- auf weitere Letztbegründungen verzichtet werden. Ist die Gesellschaft durch Werte integriert? Allein die Zahl der gleichzeitig und nebeneinander existierenden Werte stimmt skeptisch.[83] Darüber hinaus sind viele von ihnen wiederum sehr allgemein und ihrerseits interpretationsbedürftig. Und schließlich stellt der Wertediskurs keine Regeln zur Lösung von Wertekonflikten zur Verfügung. Werte existieren gemeinhin ohne eine feststehende hierarchische Ordnung, so daß Kollisionen immer nur im Einzelfall entschieden werden können.[84] Zum einen versagt die Werte-"Lösung" damit genau dann, wenn es auf Normativität ankäme. Zum anderen trägt dies natürlich auch nicht gerade zu Komplexitätsgewinn bei. Jedenfalls stellt sich die Konzeption der Werte gerade nicht als materielle Integrationsquelle, sondern als Semantik heraus; deren Tauglichkeit -- auch und gerade im Rahmen der Verfassung -- soll weiter unten (sub VII.) genauer thematisiert werden.
Mit der Fokusverschiebung von Anleitungen, die die Gegenwart generiert, auf solche Umstände, aus denen wir heute zwar Einheit schöpfen können, die jedoch eigentlich primär in der Vergangenheit begründet liegen, geraten wir in eine Diskussion, die sowohl aktueller Natur als auch von seltener Kontroversität ist. Die deutsche Vereinigung, das Auseinanderfallen der ehemaligen Sowjetunion und des ehemaligen Jugoslawiens, und die fortschreitende europäische Integration haben das Thema der nationalen Identität, des Demos und der Nation einschließlich aller mit diesen Begriffen zusammenhängenden Probleme in den Brennpunkt der politischen und wissenschaftlichen Diskussion gerückt. Dabei richtet sich der Blick fast automatisch zurück auf die Vergangenheit. Was macht das Volk, den Demos, die Nation aus? Potentielle identitätsstiftende Merkmale finden sich viele: gemeinsame Sprache, geschichtliche Erfahrung, wirtschaftliche Homogenität, Kultur, Ethnos, religiöse Tradition, gemeinsames Schicksal, zivilisatorische Standards, geopolitische Lage, Ethos, sense of belonging. Weder sind dies ausschließlich objektive Vorgegebenheiten noch rein subjektive Empfindungen. Es handelt sich um eine recht heterogene Mischung von Kriterien, die allein dadurch geeint werden, daß sie allesamt auf eine kollektive Herkunft hinweisen, die sich in der Gegenwart integrierend nierderschlägt. Damit handelt es sich zugleich, insbesondere in Deutschland, um ein heißes Eisen. Erfahrungen kollektiver Einigkeit in der jüngeren deutschen Geschichte haben immerhin zu ethnisch definierter Homogenität, "Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen"[85], Weltkrieg und Holocaust geführt. Somit ist die deutsche Wissenschaft -- zwischen zorniger Kritik und fast trotziger Behauptung oszillierend -- damit beschäftigt, einen gangbaren Weg aus dem Dilemma der zentrifugalen Bewegungen innerhalb der Gesellschaft zu finden, die Autorität nicht nur staatlichen Ursprungs zu unterminieren drohen.[86]
Bereits der konfliktträchtigen Debatte kann ein erster Hinweis darauf entnommen werden, daß zwar jeder einzelne der genannten Begriffe als integrierend verstanden werden kann und auch wird -- daß aber die Pluralität der angebotenen Konzepte ein Einigsein auf einen oder gar eine Reihe von ihnen nicht zuläßt. Im Gegenteil deutet v.a. die wissenschaftliche Diskussion daraufhin, daß die Bandbreite der als integrativ in Betracht kommenden Möglichkeiten eher Zwietracht sät und Unruhe stiftet.
Gilt dies zwar in entscheidendem Maße für die akademische Gemeinschaft, so ist damit noch nicht gesagt, ob und in welchem Maße die angeführten Kriterien nicht doch sinnstiftend wirken. Darüber hinaus ist auch zu unterscheiden zwischen Konzeptionen, die despkriptiv arbeiten und solchen, die normativen Anspruch erheben. Soweit ersichtlich, wird etwa nirgends behauptet, daß eine gemeinsame ethnische Herkunft entfremdend wirkt. Dagegen wird scharf kritisiert, ethnische Abstammung als normatives Kriterium zu begreifen und in den Bereich des "Geltens" -- sei es rechtlicher, sei es moralischer Art -- zu holen. Der begrenzte Rahmen des vorliegenden Beitrages läßt unmöglich ein erschöpfendes Eingehen auf die angebotenen Lösungen zu. Jedoch soll nicht versäumt werden, wenigstens einige Gedanken zu manchen Konzeptionen zu skizzieren, die wiederum Zweifel an ihrer Leistungsfähigkeit aufkommen lassen. Exemplarisch beschäftigen sich die folgenden Abschnitte in knappen Zügen mit Kultur und Nation, wobei Seitenblicke auf ähnlich gelagerte Fälle gewagt werden.
Immer wieder ist zu vernehmen, daß Deutschland als "Kulturstaat"[87], gewissermaßen innerlich kulturell geeint, in der Welt auftritt. Danach leistet Kultur einen Gutteil der Integration, die für eine funktionierende Demokratie scheinbar unerläßlich ist. Weiterhin hat Kultur (nach demselben Verständnis) weit über das hinaus, was der Politik möglich war, sogar den Eisernen Vorhang überwinden können und trotz der Berliner Mauer die Aussicht auf ein vereintes Deutschland lebendig erhalten. In diesem Sinne informiert uns etwa Art. 35 Abs. 1 des Einigungsvertrages:
"In den Jahren der Teilung waren Kunst und Kultur - trotz unterschiedlicher Entwicklung der beiden Staaten in Deutschland - eine Grundlage der fortbestehenden Einheit der deutschen Nation. Sie leisten im Prozeß der staatlichen Einheit der Deutschen auf dem Weg zur europäischen Einigung einen eigenständigen und unverzichtbaren Beitrag. Stellung und Ansehen eines vereinten Deutschlands in der Welt hängen außer von seinem politischen Gewicht und seiner wirtschaftlichen Leistungskraft ebenso von seiner Bedeutung als Kulturstaat ab. ..."
Diese offizielle, vertraglich niedergelegte "Feststellung", die den Geist des achtzehnten Jahrhunderts insofern atmet, als damals kulturelle Einheit das Ersatzziel für eine nicht realistische politische Einheit anvisiert wurde, mutet im Rückblick "bizarr" an.[88] Natürlich, dies nur vorweg, kann es bei der Möglichkeit einer kulturellen Integration nicht darum gehen, sich im Schatten Nietzsches, Bachs und Schinkels zu versammeln -- dies hieße, Kultur nicht ernst zu nehmen. Vielmehr geht es um die identitätsstiftende Kraft, die Kultur heute, d.h. in ihrer zeitgenössischen Erschaffung und Rezeption (manche würden sagen: Produktion und Konsumtion) besitzt. Hier scheinen Rück- und Ausblick eher nachdenklich zu stimmen. Bereits weit vor der Vereinigung konnte im kulturellen Bereich eine Tendenzwende wahrgenommen werden, die das links-kollektivistische Projekt zugunsten eines eher durch subjektive Erfahrung geprägten und ans Hedonistische grenzenden Impetus verließen. Die der "technologischen Rationalität" kritisch gegenüberstehenden Thesen von Horkheimer und Adorno in der "Dialektik der Aufklärung"[89] wurden aufgenommen und etwa im "Freibeuter" weiterentwickelt; der Intellektuelle wird in Sloterdijks "Kritik der zynischen Vernunft"[90] als zynischer Voyeur vorgestellt. Auf der anderen Seite bilden sich soziale Bewegungen, die dem mit Aktivismus und Energie entgegentreten. Hier scheint sich die "postmoderne Wende" zu bewahrheiten, ziehen sich diese Strömungen doch von den "großen Erzählungen" zurück, um kritische Positionen unter Einbringung persönlicher Erfahrungen als Konsumenten, Frauen usw. aufzunehmen. Es ist nun wiederum ein leicht paradox-zynisches Merkmal, daß diese Form der Ideologiekritik, die eine Vielzahl Intellektueller, Kulturschaffender sowie auch ebenso Angehörige etablierter Parteien vereinigte, auf "neue große Erzählungen" zurückgreifen mußte, wie etwa diejenige der ökologischen Versöhnung von Natur und Technologie.[91]
Wie sich zeigt, hat sich Kultur in Deutschland enorm aufgefächert und in zunehmendem Maße Medienräume zur Verfügung gestellt, in denen sich ein fortwährender öffentlicher Diskurs über die wechselnden Nöte und Werte der Gesellschaft etablieren konnte. Dies hat auch mit Jürgen Habermasi Beobachtung zu tun, nach der sich Kultur in eine neue Nähebeziehung zur Politik gezogen fühlt: Eine "neue Intimität zwischen Kultur und Politik" präge die Gegenwart.[92] Während auf der einen Seite Politiker nach neuen Legitimationsinstrumenten in der Kultur suchten, um Versäumnisse im wirtschaftlichen Bereich zu kompensieren, formiere auf der anderen Seite eine wache öffentliche kulturelle Diskussion die Politik neu, was sogar eine aufklärerische Perspektive schaffe.[93] Trifft diese Diagnose zu, so braucht uns nicht zu verwundern, daß es der Kultur kaum gelingt, übergreifenden Konsens herzustellen. Vielmehr bezieht sie Position und nimmt damit am pluralistischen Wettstreit teil; sie wird selbst "pluralisiert". Dies wurde nirgends deutlicher als nach der Vereinigung, als sich ein "kultureller Konsens" und eine "fortbestehende Einheit" als offensichtlich illusionär herausstellte. Der Literaturstreit, katalysiert durch Christa Wolfs Text "Was bleibt" von Juni 1990 und mit der IM-Enttarnung des der Prenzlauer Berg-Szene angehörigen Dichters Sascha Anderson 1991 als medienwirksamem Höhepunkt, führte bei weitem nicht nur zu einer Neueinschätzung der DDR- (sowie der westdeutschen) Literatur, sondern zu einer heftigen Auseinandersetzung über die deutsche Identität. Die unterschiedlichen Implikationen, die dem "Kulturstaat" einerseits von Regierungsseite (oder auch Martin Walser), andererseits von Günter Grass[94] beigegeben wurden, verdeutlichen das Ausmaß des Konflikts. Schlagworte wie das von der "deutschen Gesinnungsästhetik"[95] waren ein Schlag ins Gesicht der deutschen kulturellen Tradition über die Nachkriegsliteratur und -kunst hinaus. Unumgängliche Schlußfolgerung kann danach nur die des kulturellen Pluralismus sein.[96] Kultur als "nicht-kontroverser Sektor" des gesellschaftlichen Pluralismus scheidet jedenfalls aus.
Und dies ist nur die eine Seite. Bisher wurde der Kulturbegriff -- auch im vorliegenden Beitrag -- in einer besonderen, einseitigen Weise verwendet, nämlich (vereinfachend gesagt) im Sinne eines bildungsbürgerlichen Verständnisses. Es ging um "hohe" Kultur, Qualitätskultur, ernsthafte Kunst; Kulturkritik, politische Essays, Gedichte, Feuilletons. Ausgeschlossen aus dieser Betrachtung ist die Massen- oder Populärkultur, die aber etwa angesichts der zunehmenden Privatisierung des Fernsehens einen immer größeren Raum einnimmt.[97] Dieser Ausschluß ist zugleich ein Urteil; man beklagt implizit die schlechte Qualität des Fernsehprogramms, also das, was als "trash TV" bekannt ist. Subtil handelt es sich dabei ebenso um Negativ-Urteil über die Präferenzen der Fernsehzuschauer, die sich in den Einschaltquoten dokumentieren. Ein solches Kulturverständnis setzt sich leicht dem Vorwurf des Elitismus oder, wie genauer unten[98] erläutert wird, des Progressivismus aus[99]. In der Tat läßt sich ein Trend ausmachen, wonach die Grenzen zwischen "high" und "low culture" zunehmend verschwimmen.[100] Ist es unter diesen Umständen ohne weiteres möglich, Populärkultur entweder zu ignorieren oder zu attackieren?[101] Es handelt sich hierbei um das tiefere Problem der ideologischen Kritik.[102] Konsens unter diesen Bedingungen ist zweifelhaft.
Auf einer noch weiteren Stufe stellt sich schließlich die Frage, welche Kultur denn nun maßgeblich sein soll. In bezug auf praktisch jedes Thema existieren nämlich eine ganze Reihe von "traditionalen Erzählungen", die mitunter diametral entgegengesetzt sind. Welche von ihnen machen nun unsere "Kultur" aus? Welchen vertrauen wir die Funktion an, Werten durch ihre vorgebliche Verwurzelung in Traditionen -- also der Tatsache, daß sie von vielen Menschen über eine lange Zeit hinweg akzeptiert wurden -- ihre Subjektivität zu nehmen und damit Einwände auszuschließen? Als Beispiel seien etwa homosexuelle Beziehungen genannt: Ihre Geschichte ist bis mindestens in das antike Griechenland zurückreichend dokumentiert. Dennoch schrieb der Präsident des US-amerikanischen Supreme Court Warren Burger in der Entscheidung Bowers v. Hardwick: "Condemnation of those practices is firmly rooted in Judaeo-Christian moral and ethical standards."[103] Die Privilegierung letzterer Tradition gegenüber der zuerst genannten stellt ohne Zweifel eine Wertentscheidung der Richter dar; worauf es aber hier ankommt, ist die Tatsache, daß häufig gegenläufige traditionale Erzählungen vergleichbarer Wertigkeit -- gerade im kulturellen Bereich -- miteinander konkurrieren.[104]
Daß uns überhaupt die Idee gekommen ist, Kultur als integrativ bzw. als konsensstiftend in Betracht zu ziehen, wird Niklas Luhmann nur mit kopfschüttelnder Ungläubigkeit quittieren können. Sogar über das hinaus, was die funktionelle Ausdifferenzierung der Gesellschaft an Integrations-Unfähigkeit mit sich bringt, kann Konsens jedenfalls der Kultur nicht anvertraut werden. Von der eben festgestellten Pluralisierung abgesehen liegt dies am Kulturbegriff selbst. Als Gedächtnis sozialer Systeme, v.a. des Gesellschaftssystems, wirkt Kultur genau in die Gegenrichtung. So schreibt Luhmann:
"Der Begriff iKulturi ... beobachtet sich selbst und alles, was unter ihn fällt, als kontingent. Je mehr die Reflexion Notwendiges sucht (zum Beispiel unbedingt geltende Werte), desto mehr erzeugt sie im Effekt Kontingenz (zum Beispiel iWerteabwägungeni). Das hat zur Folge, daß Themen, die früher modaltheoretisch [etwa hierarchisch] abgefangen und als inotwendigi oder als iunmöglichi dargestellt wurden, jetzt konsensbedürftig werden und mit ensprechenden Zumutungen kommuniziert werden müssen. ... Danach überzieht die Semantik der Kultur alles, was kommuniziert werden kann, mit Kontingenz. Sie befreit von jeder Art notwendigem Sinn - und auch das erklärt, daß Kultur erst in der modernen Gesellschaft möglich wird, die sich erstmals als strukturell kontingent und zugleich nur noch so reflektieren kann."[105]
Alles weist demnach auf eine "Rhetorisierung" hin, d.h. darauf, daß auch der kulturelle Integrationsbegriff seines materiellen Inhalts entkleidet ist und stattdessen -- um es mit Burns und van der Will positiv auszudrücken -- als "necessary discursive process" erscheint "in which the whole of German society is involved in the pursuit of a consensus of values and national identity within a situation of accelerating social change (modernization)".[106]
Die Debatte über den Begriff der Nation erhält deshalb in Deutschland eine besondere Brisanz und Dringlichkeit, weil hier zwei Strömungen machtvoll aufeinandertreffen: die allgemeine Entmystifizierung und Dekonstruierung der Nation einerseits, und die durch die deutsche Vereinigung hervorgerufene Rückbesinnung auf die Möglichkeit "nationaler Integration" andererseits. Die hierdurch ausgelöste Literaturflut ist kaum mehr zu überschauen.[107] Mit Recht hebt Ernst-Wolfgang Böckenförde hervor, daß der Begriff der Nation nicht mit einem von vornherein feststehenden Bedeutungsinhalt verknüpft ist: Vielmehr bestimmt die Nation die Merkmale, die sie bestimmen, selbst.[108] Nation liegt insoweit quer zu kollektiven Identitätsanknüpfungen an Sprache, Ethnos, Religion, sense of belonging etc. Es handelt sich um einen Rahmen, der variabel nach Raum und Zeit mit unterschiedlichem Sinn belegt werden kann.[109] Wir begegnen also wiederum unserem Motiv der Pluralisierung, diesmal exerziert am Begriff der Nation. Jedoch -- um ein weiteres postmodernes Thema aufzunehmen, das nebenbei auch durch den Kommunitarismus ins Blickfeld gerückt ist -- soll der Präferenz für Lokales und Spezifisches gegenüber Universellem und Abstrakten einmal nachgegeben und weitergefragt werden, wie es mit dem Gedanken der Nation in Deutschland bestellt ist. Es überrascht nicht, hier auf Kontroverses zu stoßen. Böckenförde etwa führt uns behutsam auf den Weg einer ausdrücklich ethnisch-kulturell definierten deutschen Nation. In Abgrenzung etwa von Frankreich habe sich das erwachende politische Selbstbewußtsein Deutschlands am Ende des 18. und im frühen 19. Jahrhundert nicht mit einem Staat identifizieren können und deshalb auf Merkmale wie Sprache, Abstammung, Geschichte, Kultur zurückgegriffen.[110] War die "Kulturnation" zunächst lediglich ein Ausdruck des "Eigenen", vor allem gegenüber Frankreich, so wurden die genannten Merkmale nunmehr ins Politische gewendet und damit "zu bestimmenden Merkmalen einer potentiellen Staatsnation gemacht".[111] Noch immer sei dieses Verständnis von Nation für Deutschland bestimmend. Zwar kann sich der "nationale Bewußtseinsprozeß", so konzediert Böckenförde, verändern oder fortentwickeln; und so "erscheint es auch möglich, eine ethnisch geprägte Nationalidentität, wie es nach wie vor für Deutschland ... bestimmend ist, zu einer anders gearteten oder anders akzentuierten Nationalidentität umzubilden".[112] Voraussetzung hierfür aber seien etwa grundstürzende politische Ereignisse, geistige Bewegungen, Anstöße durch herausragende politische Führer, tragende politische Ideen, emotional bindende große Geschehnisse, die sich dem kollektiven Gedächtnis einbilden.[113] Nichts von dem sei in Deutschland gegeben.
Nun geht es vorliegend nicht darum, Böckenförde zu widerlegen. Vor allem kann nicht ernsthaft bezweifelt werden, daß nicht das Verlangen, in einer auf universale Prinzipien wie Freiheit und Gleichheit gestützten politischen Ordnung leben zu wollen (wie etwa in den USA), sondern die staatlose Kulturnation mit organischen Merkmalen am Anfang der deutschen nationalstaatlichen Entwicklung stand.[114] Und doch wird ebensowenig angezweifelt werden, daß das Konzept des Nationalstaates gerade in Deutschland besonders unterminiert ist durch die Perversion des Nationalismus im Rahmen der politischen und moralischen Katastrophe des Nationalsozialismus -- der Historikerstreit ist hier nur ein Zeuge unter vielen. Zum einen hilft in diesem Dilemma die bereits oben angerissene Unterscheidung zwischen deskriptiv-analytisch und normativ weiter: Was gestern gewesen ist, muß heute (und morgen) nicht gesollt sein. Zum anderen gilt es zu bedenken, daß auch Böckenfördes Analyse nicht autoritativ ist. Es würde etwa einleuchten einzuwenden, daß gerade die von ihm selbst aufgestellten Voraussetzungen für eine Weitergeltung des ethnisch-kulturellen Nationenbegriffs nicht gegeben sind, nämlich die Vermittlung ins allgemeine Bewußtsein, insbesondere durch die Schule.[115] Vielmehr war der schulische Unterricht seit Ende des nationalsozialistischen Regimes gerade durch die Abwesenheit der Vermittlung eines ethno-kulturellen Nationbegriffs gekennzeichnet. Das "grundstürzende politische Ereignis", die "geistige Bewegung", die Böckenförde zur Abänderung eines einmal gebildeten Verständnisses von Nation fordert, ist mithin längst geschehen, vor über 50 Jahren. So gesehen erstaunt es, daß dieser tiefe Einschnitt nicht als solcher wahrgenommen wird.[116]
Andere Konzeptionen werden durchaus vertreten. In der Nähe zu Böckenförde und vor allem zu Paul Kirchhof ist zwar das Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu lokalisieren, das aber, wie bereits erwähnt, sich selbst scheinbar auf unsicherem Boden wähnt und zumindest den (sibyllinisch wirkenden und nicht überzeugenden) Versuch macht, zusätzlich pluralisierende Gedanken miteinzubringen. Als großer Gegenentwurf ist vor allem der insbesondere von Jürgen Habermas vorgetragene Verfassungspatriotismus zu nennen. Danach ist "[d]er einzige Patriotismus, der uns dem Westen nicht entfremdet, ... ein Verfassungspatriotismus. Eine in Überzeugungen verankerte Bindung an universalistische Verfassungsprinzipien hat sich leider in der Kulturnation der Deutschen erst nach - und durch - Auschwitz bilden können."[117] Mit Sicherheit handelt es sich nicht um "einen der vielen iunpolitischen Seminargedankeni deutscher Intellektuellentradition"[118], sondern um ein sehr ernst zu nehmendes politisches Projekt. Dieses ist auch nicht, wie Böckenförde meint, "auf die Situation der Teilung Deutschlands bezogen"[119], sondern, wie seine Verfechter nicht müde werden darzulegen, gerade von Bedeutung für das vereinigte Deutschland.[120] Ernster zu nehmende Kritik richtet sich darauf, daß es sich beim Verfassungspatriotismus um "cold rationalism"[121] handelt, dem die emotionalen Identifikationsmöglichkeiten abhanden gekommen sind.[122] In der Tat berücksichtigt Verfassungspatriotismus die emotionale Anziehungskraft zu wenig, die von einem ethno-kulturellen Demos ausgeht. Dieser formt den Mythos der nationalen Identität aus zwei Werten: Zugehörigkeit (ein in sich besonders machtvoller Faktor, wenn man die dramatischen Gegensätze bedenkt: Isolation, Ausschluß, Exkommunikation) und Originalität.[123] Die Anziehungskraft reicht sogar noch tiefer: "Durch die Anklänge an Schicksal und Vorsehung kann Nationalismus das tiefste existentielle Verlangen befriedigen, das Verlangen nach Sinn und Zweck der Existenz, die das schiere Existieren oder egoistische Selbstverwirklichung überschreiten."[124] Die von Weiler vorgeschlagene Lösung ist im Grunde eine konservative, auch wenn dies in der Hitze mancher Debatte untergeht. Ein ethnisch-kulturell geprägter Demos hat -- neben den immensen Gefahren -- auch viele Tugenden: etwa Loyalität unter Toleranz für andere Loyalitäten (z.B. Familie), oder Befriedigung des eben erwähnten Drangs nach Identität und ontolgischem metaphysischem Sinn. Daher will Weiler einer solchen Konzeption im Grunde nichts anhaben. Aber er verdeutlicht die Risiken, um sie schließlich auf supranationaler Ebene durch andere Loyalitäten (European Citizenship) einzudämmen und abzufedern, und damit einem Mißbrauch entgegenzuwirken.[125]
Findet die sich allzu häufig als analytisch-deskriptiv maskierende normative Debatte auf einem solchermaßen abgesteckten Feld statt, so verlassen wir den Schauplatz. Unsere knappen Erörterungen haben ergeben, daß der Nationbegriff pluralisiert ist und z.B. als (ethnisch-kulturelle) Herkunftsgemeinschaft, als (politischer) Willensverband oder als (religiöse) Heilsgemeinde verstanden werden kann.[126] Sein deskriptiver Gehalt ist historisch kontingent; dies gilt noch viel mehr für seinen normativ-teleologischen Gehalt. In Deutschland versagt sogar die einigende Kraft des Mythos nationaler Identität, wodurch dem Konzept der Nation für das Projekt der Integration auch der letzte Rest einheitsstiftender Kraft abhanden kommt. Ist von der "deutschen Nation" die Rede, so ist dies eine rhetorische Beschwörung nicht vorhandener Einheit. Um überhaupt Sinn zu machen, muß der Nationbegriff qualifiziert werden -- dann aber verliert er von vornherein seine (wenn auch nur rhetorisch) integrative Aura.
Nation, ebenso wie Kultur, können im materiellen Sinne die Integration der modernen Gesellschaft nicht mehr leisten. Gleiches gilt für Sprache (man frage nur die Schweizer; oder, andersherum, die Österreicher) und für Geschichte (die nicht objektiv existiert, sondern ebenfalls pluralistisch interpretiert wird).
Nun scheint aber zwischen dieser Diagnose und dem eingangs gewählten Ansatz unmittelbar ein evidenter Widerspruch zu liegen. Wurde nicht oben ausdrücklich gesagt, daß es einen Grund dafür geben muß, daß sich Individuen mit dem Mehrheitsprinzip abfinden, und zwar innerhalb bestimmter Grenzen eines bestimmten Gemeinwesens? Dann, so die scheinbar logische Schlußfolgerung, muß ein bestimmtes Band zwischen ihnen sein. Es mag sein, daß Individualität und Freiheit Grundlage einer jeden Demokratie sind; aber zugleich muß auch etwas Gemeinsames existieren, das die Gemeinschaft zusammenhält.[127] Hieraus den Schluß auf ein aktuell vorliegendes integrative Element ziehen zu wollen liegt zwar nahe, ist aber nicht geboten. Grund hierfür ist das, was ich den "MS-DOS-Effekt" nennen will. Das Computer-Programm MS-DOS hat Jahre überdauert und ist in IBM-kompatiblen Rechnern noch immer Grundlage aller anderen Systeme, obwohl es längst weder den Ansprüchen noch dem Forschungs- und Entwicklungsstand moderner Informationstechnik entspricht und durch komplizierte Techniken "überbaut" werden muß. James March und Johan Olsen weisen darauf hin, daß in Technologiestudien ähnliche Phänomene unter der Überschrift "lock-ins" oder "network externalities" untersucht werden. Technologien, die ein System zusammenhalten, tendieren dazu fortzubestehen, obwohl die Umstände, die zu ihrer Entstehung geführt haben, sich längst geändert haben. Es handelt sich also bei diesem Effekt um das Phänomen, wie sich integrierende Elemente halten und gegen Umweltveränderungen immunisieren können. Neben der Technologie kann dieser Umstand in anderen Bereichen auftreten -- darunter auch im gesellschaftlich-politischen. Als Beispiele werden die Grenzen, Sprache sowie zahlreichen kulturellen und institutionellen Einrichtungen genannt, die die längst vergangene imperialistische Herrschaft Großbritanniens und Frankreichs hinterlassen hat; ebenso die Bräuche und Institutionen, die etwa deutsche Eroberer in Norwegen oder amerikanische Eroberer in Japan eingeführt haben.[128] Integrative Elemente können also scheinbar fortbestehen, ohne daß die jeweiligen Voraussetzungen zu ihrer Entstehung zu jeder Zeit weiterhin vorliegen müssen. Nun scheint der Vergleich zu hinken: MS-DOS leistet auch zu einem Zeitpunkt der völligen technologischen Überholung noch immer eine "Integration" der Festplatte. Die englische oder die französische Sprache sowie die im Imperialismus mitgebrachten Verwaltungsstrukturen, -institutionen und -kulturen stellen etwa in manchen Gebieten Afrikas noch immer ein gemeinsames Band dar. Also doch: Integration durch Moral, Kultur usw. im Sinne eines "lock-ins" -- also immerhin eine "second order"-Integration, auf indirektem Wege? Wir wollen den Vergleich dahingehend aufrechterhalten, daß in der Tat die rhetorischen Strukturen weiterhin existieren. Wer wollte einen machtvollen Wertediskurs in der heutigen Gesellschaft abstreiten? Liegt die Lösung unseres Integrations-Problems also in der Rhetorik? Sind wir dadurch geeint, daß wir bestimmte Mythen aufrechterhalten? Ist der Mythos der Integration, von dem der vorliegende Beitrag handelt und dessen substantielle Entleertheit die obigen Ausführungen nahgebracht haben, selbst das einigende Moment -- als Form? Dies wäre hochgradig paradox, da sich dann die Rhetorik, die im eigentlichen Sinne nicht die Realität reflektiert, diese dann aber so formt, daß sie plötzlich zutrifft (wenn auch auf andere als die behauptete Art und Weise[129]). Ein Fall für Niklas Luhmann und eine "Rhetorik der Gesellschaft" -- integriert sich die moderne Gesellschaft vor den (rhetorischen) Fassaden Potemkinscher Dörfer?[130]
Möglicherweise hat dies einmal zugetroffen, und es wäre an der Zeit, dies zu analysieren. Jedoch handelte es sich dann um eine historische Analyse. These der vorliegenden Ausführungen ist nämlich, daß -- selbst für den Fall, daß die eben beschriebene Paradoxie einmal bestanden haben sollte -- diese Phase nunmehr hinter uns liegt. Merkmal der Gegenwart, so die hier vertretene Auffassung, ist gerade die Unfähigkeit des Diskurses zur Integration. Auch die Rhetorik hat -- jedenfalls bis zu einem bestimmten Maße -- an gemeinschaftsbildender Kraft verloren.[131] In den folgenden Abschnitten wird zu zeigen sein, daß dies auf Dauer nicht zu vermeiden war und daß die -- am Anfang des Beitrages dargelegten -- institutionellen und gesellschaftlichen Positionierungen in Deutschland zu einem noch schnelleren Verfall beigetragen haben.
Die allgemeine Bewegungsrichtung läßt sich schnell skizzieren. Während die klassische Pluralismustheorie noch mit "overlapping memberships" beschäftigt ist, zeichnet sich längst das Paradigma der Inkommensurabilität als neuer Grundbegriff des Pluralismus ab. Die Kritik szientistischer Rationalität, aus der Kunst in die Wissenschaft getragen, führt zwar nicht, wie Bernhard Willms meint[132], zu einer Entsprechung des Hobbesschen Naturzustandes, aber doch zu den bekannten "mehreren Wahrheiten". Dies hat nicht nur zur Konzequenz, daß ein substantieller Konsens nicht mehr möglich ist, sondern ebenso, daß es zunehmend schwerer fällt, diese mehreren Wahrheiten rhetorisch zu verklammern. Je weiter die Pluralisierung fortschreitet, um so mehr diskursive Möglichkeiten zur Einheitsbildung werden abgeschnitten. Für die Rhetorik bedeutet dies, daß es sich um einen unaufhaltsamen Prozeß zunehmender Generalisierung handelt. Die Sprache wird notgedrungen immer allgemeiner, um weiterhin alle oder doch den Großteil[133] der vertretenen Meinungen integrieren zu können.
Daß dieser Prozeß nicht unendlich sein kann, leuchtet unmittelbar ein. Irgendwann wird die Rhetorik als solche durchschaubar. Dies wird genau dann der Fall sein, wenn der Grad an Allgemeinheit ein derartiges Ausmaß erreicht, daß die diese Sprache verwendende Institution entweder in Abgrenzungsschwierigkeiten (und damit in eine organisationseigene "Identitätskrise") gerät oder aber etwaig zu fällende Entscheidungen als Dezisionismus inmitten von Beliebigkeit erscheinen. In der Tat ist es so, daß, sobald die Sprache als dasjenige Mittel versagt, mit dem sich eine Institution gegenüber seiner Umwelt (etwa der Gesellschaft) verständlich macht, diese Kommunikationskrise unmittelbar in eine Krise der Institution selbst umschlägt. Dabei stellt sich häufig ein Gefühl des gegenseitigen Unverständnisses ein: Die Beobachter der Institution reagieren mit verärgerter Unduldsamkeit, während diese selbst sich meistens von der Kritik überrascht und sich "ungerecht behandelt" sieht.
Als Beispiel seien die Primärkandidaten für eine solche Krise genannt, die politischen Parteien. Gemäß Art. 21 Abs. 1 S. 1 GG besteht ihre Aufgabe darin, an der Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Dies freilich ist nicht gerade ein klarer Auftrag, und so gibt es auch genügend Streit, sowohl rechts- wie politikwissenschaftlicher Provenienz, über die korrekte Einordnung: "Von Herkunft zweifellos gesellschaftlich, ist ihr Ziel doch der Staat."[134] Damit ist auch schon die grundlegende Doppelrolle der politischen Parteien umschrieben. Zum einen nehmen sie an der Volkswillensbildung dadurch teil, daß sie etwa[135] im Rahmen der Wahlvorbereitung "die gesellschaftliche Vielfalt in einem Prozeß fortschreitender Selektion auf wenige entscheidungsfähige Alternativen reduzier[en]..., indem sie verwandte Meinungen und Interessen zusammenfassen, in sich ausgleichen und zu politischen Programmen verdichten".[136] Daneben bleiben die Parteien in den gewählten Organen präsent und werden damit zum Träger staatlicher Kompetenzen.
Hieraus folgt ein fast schon tragisches Dilemma der politischen Parteien in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist bereits der Selektionsprozeß ein fast aussichtsloses Unternehmen, wenn, wie wir festgestellt haben, sich die Gesellschaft immer mehr pluralisiert. Da Parteien darauf angewiesen sind, gewählt zu werden, und insofern mehrheitsabhängig sind, müssen ihre Programme immer allgemeinere Züge annehmen. Dies führt erstens dazu, daß die angebotenen Formeln mit zunehmender Generalität ihren Sinn (und damit auch ihre Integrationskraft) verlieren: Irgendwann ist der Bogen gewissermaßen überspannt, und der rhetorische Ausgriff auf immer mehr in der Gesellschaft vertretene Meinungen, Interessen und "Wahrheiten" schlägt in sein Gegenteil um, so daß jegliche Identifikation verunmöglicht wird. Zweitens wird dieser Prozeß dadurch katalysiert, daß es allen Parteien gleich geht und sich die Programme einander annähern. Es entstehen politische Abgrenzungsschwierigkeiten, die die Parteien in nicht zu unterschätzende Profilnöte treiben. Gegen beide (unvermeidlichen) Probleme reagieren Parteien mit der Personalisierung von politischen Problemen -- eine Lösung, die zwar den Erfordernissen insbesondere des Fernsehens entspricht, aber kaum befriedigend Unsicherheit absorbiert und nur zu neuer Unzufriedenheit führt.
Zum anderen steht auch der Vermittlungsprozeß von der "Partei im Staat" zur Gesellschaft hin vor ähnlichen Schwierigkeiten. Der Verallgemeinerungsprozeß findet notgedrungen auch hier statt, nur umgekehrt in der Vermittlung von Entscheidungen an pluralistische Erwartungen in der Gesellschaft. Diese Schwierigkeit identifiziert Luhmann, wenn er bemerkt, daß "die Anpassung [von Parteiprogrammatik] an die Realität der sozialen Erwartungen über Reden erfolgt und nicht (wie zum Beispiel bei Wirtschaftsbetrieben, Krankenhäusern, Polizeidiensten, Gerichten) über ein spezifisches Produkt".[137] Dies führt zur Unzufriedenheit (sowohl innerhalb als auch außerhalb der Partei) über eine Ungleichgewichtung zwischen Reden und effektivem Handeln.
In der Debatte über die Rolle und Performanz politischer Parteien in Deutschland wird die Verantwortungslast für Parteiverdrossenheit und -entfremdung überwiegend den Parteien selbst aufgebürdet. Dies geschieht in verschiedenen Argumentationsschemata: Vertreter aller Parteien als Mandatsinhaber haben sich finanzielle Vorteile zugeschanzt; den Parteien ist es nicht gelungen, dringende Aufgaben (Vereinigung Deutschlands, Auflösung des Ostblocks) "gemeinschaftlich anzupacken"; ihre Repräsentanten sind der großen Rolle, die Parteien im öffentlichen Leben der Bundesrepublik spielen, nicht gewachsen; die Parteien schließen sich gegenüber dem Geist der Gesellschaft ab oder nehmen nur bestimmte Elemente dieses Geistes in sich auf[138]; sie verschwören sich im Rahmen einer Art ABM-Strategie, indem sie ihre Mitglieder mit staatlichen, insbesondere aber Verwaltungspositionen versorgen und zugleich als Plattformen dienen, auf denen "Notstände" inszeniert werden, die nach Einstellung von noch mehr Verwaltungspersonal verlangen[139]; sie beanspruchen ein Repräsentationsmonopol für die Gesellschaft in allen politischen Fragen und benutzen die staatliche Macht zu seiner Absicherung; sie wecken Erwartungen, die großenteils nicht erfüllbar sind und sind überhaupt allgegenwärtig, was ganz allgemein ausreicht, um Verdruß zu erzeugen.[140] Dabei wird übersehen, daß sowohl die zunehmende gesellschaftliche Pluralisierung einerseits und die Strukturierung des politischen Systems andererseits, insbesondere die Notwendigkeit von immer neuen Mehrheiten, die Parteien geradewegs in ihre gegenwärtige Misere lenkten.
Es ist kein Wunder, daß das Verlangen der politischen Parteien nach Zustimmung mit Verdruß und Verachtung beantwortet wird -- daß es gerade die Parteien als erstes "erwischt hat". Ihr Auftrag ist es, zwischen der Gesellschaft (die nach herrschendem deutschen Staatsverständnis eine egoistische Sphäre ist) und dem Staat (als läuternde und Rationalität verkörpernde Organisation) zu mediatisieren. Dies kann auf Dauer nicht gutgehen, insbesondere dann, wenn sich die Gesellschaft zu emanzipieren beginnt. Daß die Parteien damit als Blitzableiter für den Staat fungieren müssen, beschreibt wiederum Niklas Luhmann:
"Die politischen Parteien werden dem Komplexitätsdruck unmittelbar ausgesetzt, ja durch das System der Parteienkonkurrenz dazu angeregt, sich aktiv um inkonsistente Entscheidungsgrundlagen, um Innovation, um Öffnung für immer neue Themen zu bemühen. Sie haben damit die Aufgabe, Themen und Personen auf politische Tragfähigkeit zu testen, Konsenschancen vorzuprobieren, ohne gleich schon auf Durchsetzung des Erwogenen verpflichtet zu sein."[141]
Wie im folgenden Abschnitt aber gezeigt werden wird, machen die Konsequenzen der Pluralisierung nicht mehr vor den Vermittlern halt. Sie haben sich ihren Weg längst bis zum läuternden Staat gebahnt, vor allem zum Parlament, aber (abgeschwächt) auch zur Regierung. Pointe des Beitrages ist es zu zeigen, daß sie nunmehr auch das Zentrum der staatlichen Rationalität und Tugend erreicht haben: das Bundesverfassungsgericht.
In bezug auf die politischen Parteien kann es nur beschränkt Verwunderung auslösen, daß eine pluralisierte Gesellschaft sich ihrer kritisch bemächtigt. Immerhin sind sie, nach der wohl noch immer herrschenden (und gerade im rechtswissenschaftlichen Schrifttum weitaus überwiegenden) Auffassung keine reinen Verfassungsorgane.[142] Sie besitzen ein "natürliches Substrat in den unterschiedlichen Interessen und Ordnungsvorstellungen der Gesellschaft".[143] Insofern erscheint es fast selbstverständlich, daß sie in ihrer Mediatisierungs- und Blitzableiterfunktion anfällig und labil sind. Anders ist dies im Hinblick auf den Staat. Wie eingangs angedeutet wurde, wird dieser geradezu als Antithese der Gesellschaft verstanden: monolithisch, nicht pluralistisch; altruistisch, nicht egoistisch; Freiheit gewährend, nicht Freiheit genießend; deliberativ, nicht passioniert. Dementsprechend wird dem Staat auch die immense Aufgabe der Einheitsbildung angetragen. Dies hat Hegel durch die Konzeption des sittlichen Staates erstmals brilliant ausformuliert, und zeitgenössische Staatsrechtler haben das Projekt weiterverfolgt.[144] Im ersten Band des einflußreichen Handbuch des Staatsrechts, der sich mit den "Grundlagen von Staat und Verfassung" auseinandersetzt, kann man etwa bei Josef Isensee nachlesen:
"Die Gegensätze der Gesellschaft bringen die Notwendigkeit des modernen Staates hervor. Er ist ihr Widerlager. Gegenüber dem Pluralismus hat er die Einheit, gegenüber dem Antagonismus den Frieden zu gewährleisten. ... Sein Dilemma besteht darin, über die Spaltung der Gesellschaft Einheit herstellen und wahren zu müssen, ohne hoffen zu dürfen, die Spaltung jemals zu überwinden. Das Dilemma macht die eigentliche Modernität des modernen Staates aus."[145]
Es ist der Staat, der Einheit herzustellen hat; das Mittel hierzu ist Konfliktneutralität. "Der Staat kann Einheit nur herstellen, wenn er ein Mindestmaß an Distanz zu den einzelnen Gruppen der Gesellschaft hält und wenn er die Macht besitzt, unabhängig von ihnen zu entscheiden..."[146]
Sind dies die Prämissen, so provoziert der Gedanke des läuternden Staates als Spender von Einheit und Integration geradezu Widerspruch. Lösen wir die black box "Staat" auf und zerlegen sie zumindest in die gröbsten Bestandteile, so fällt als erstes das Parlament als eine Institution auf, die den eigenen Anforderungen dieser Konzeption kaum gerecht wird. Kann man tatsächlich davon ausgehen, daß das Parlament "konfliktneutral" agiert? Zum einen haben wir bereits gesehen, daß die politischen Parteien "im gewählten Organ präsent" bleiben.[147] Gerhard Leibholz ging sogar so weit zu behaupten, daß im Parlament nur noch "anderweitig [durch die Parteien] bereits getroffene Entscheidungen registriert werden".[148] Dies mag recht weit ausgegriffen sein; jedoch bestätigt eine an der Verfassungsrealität orientierte Analyse durchaus den enormen Einfluß, den politische Parteien "im Amt", vor allem im Parlament, weniger in der durch vorgegebene Organisationsstrukturen und Entscheidungsprogramme fragmentierten Verwaltung[149], ausüben. Parteien aber sind gerade keine neutralen Instanzen, sondern fußen in der Gesellschaft selbst. Desweiteren zeichnen sie sich gerade durch ihre Abgrenzung voneinander aus (mit den zunehmenden, oben genannten Schwierigkeiten). Das bedeutet, daß die Partei -- und damit immer auch eine Parlamentsmehr- oder -minderheit -- bestimmten "Werten" zugeneigt, anderen gegenüber jedoch abgeneigt ist. Auch dies spricht stark gegen Neutralität. Politische Mandatsträger wollen darüber hinaus wiedergewählt werden und sind von daher darauf angewiesen, die Interessen einer bestimmten Klientel und Wählerschaft glaubwürdig zu vertreten. Dies heißt nicht, daß das Parlament vorliegend ausschließlich als Instrument reiner Präferenz-Akkomodation verstanden und ihm die Fähigkeit abgesprochen werden soll, das Gemeinwohl zu bedenken und zu berücksichtigen. Der amerikanische Civic Republicanism, der z.T. nunmehr auch seinen Weg nach Deutschland findet[150], vertritt vehement eine auf substantielle Rationalität gegründete Rolle des Staates, dem die primäre Verantwortung zukommt, das Volk in die Möglichkeit zu versetzen, über wechselnde Präferenzen in Deliberation zu treten und Konsens über das Gemeinwohl zu erreichen. Nicht ignoriert werden kann jedoch, daß keineswegs Einigkeit darüber besteht, wo institutionell der locus deliberationis anzusiedeln sei. Dabei sind auch innerhalb des Kreises der civic republicans die Stimmen unüberhörbar, die die Fähigkeit des Parlaments zur Erfüllung der ihm angesonnenen Aufgabe bezweifeln, da der Gesetzgeber overresponsive gegenüber pluralistischen Ansinnen sei.[151] Der Streit kann und braucht hier nicht entschieden zu werden; lernen aber können wir jedenfalls, daß das Parlament zumindest auch responsiv agiert und agieren muß. Nicht umsonst ist der Begriff des "responsive government" ein Schlüsselkonzept der Demokratietheorie[152], und auch nicht umsonst hat eine engagierte Diskussion Ende der siebziger Jahre das Konzept einer "optimalen Methodik der Gesetzgebung" abgelehnt.[153] Mithin reicht die gesellschaftliche Pluralisierung quasi natürlich in das Parlament (und -- in der Verlängerung -- in die von der Parlamentsmehrheit gewählte und gestützte Regierung) hinein. Dennoch sind beide Institutionen weniger anfällig als die politischen Parteien. Dies verwundert zunächst dann, wenn man weiß, daß die Balance zwischen Diskurs und effektiver Handlung, eines der Kernprobleme moderner Demokratien, sich institutionell dergestalt widerspiegelt, daß öffentliche Rede und Deliberation, mithin Rechtfertigung, traditionell in der Legislative angesiedelt wird, während insbesondere die Verwaltung eher den locus agendi symbolisiert.[154] Die im Vergleich zu den Parteien geringere Verwundbarkeit erklärt sich jedoch zum einen daraus, daß dem soziale Erwartungsdruck mit "Produkten" (um das Wort von Luhmann[155] wieder aufzunehmen) wie etwa Gesetzen (Parlament), Regierungsentscheidungen oder ministeriellen Rechtsverordnungen begegnet werden kann. Zum anderen gewährt auch der Mythos des Staates noch immer Rückendeckung, von der Parlament und Regierung zehren können. Daß dieser Mythos aber zunehmend an Substanz verliert und das Parlament, zusammen mit der Regierung, die ersten "Opfer" der gesellschaftlich-pluralisierten Entmythologisierung des Staates zu werden versprechen, scheint sich sowohl in der Müdigkeit anzudeuten, die viele Bürger heute gegenüber traditionellen (=staatlichen) Politikprozessen verspüren, in der zunehmenden Popularität der "Bewegungspolitik"[156] und des Konzeptes der Zivilgesellschaft[157], sowie im kontinuierlich sinkenden Ansehen des Parlaments und der Regierung in der Bevölkerung[158].
Sind in bezug auf Parlament und Regierung die Verbindungslinien zur Gesellschaft, die dann gewissermaßen zu Brücken oder Einbruchstellen für die Entzauberung des Staates im Zeichen der gesellschaftlichen Pluralisierung werden, problemlos in Gestalt des nachhaltigen Einflusses der Parteien und der kontinuierlichen demokratischen Verantwortlichkeit nachzuweisen, so gilt dies nicht für das Bundesverfassungsgericht. Dieses ist als Teil der deutschen Gerichtsbarkeit konzipiert (seine verfassungsrechtliche Verortung findet sich in Kapitel IX des GG, "Rechtsprechung") und ist mithin demokratischer Verantwortlichkeit zu einem großen Teil entzogen.[159] Nicht unmittelbar von Bevölkerungsmehrheiten abhängig, ist das Verfassungsgericht nicht auf direkte soziale Akzeptanz angewiesen.[160] Damit scheint eine optimale Voraussetzung für die geforderte "Konfliktneutralität" gegeben zu sein, die den Staat erst tugendhaft und läuterungsfähig werden läßt. Das Bundesverfassungsgericht sucht sich ja, so ist immer wieder zu hören, keine Lösungen aus pluralen Bausteinen unter zweckbestimmter Abwägung der Alternativen zusammen, sondern wendet die Verfassung an. Damit ist Verfassungsrechtsprechung zum einen als nicht den subjektiven Werten der Richter unterfallende, hauptsächlich deduktive Rechtsfindung identifiziert; zum anderen bezieht sie ihre Legitimation aus dem Grundgesetz, d.h. der weitesthin konsentierten Grundordnung des Gemeinwesens. Mit anderen Worten können wir die Verfassungsgerichtsbarkeit -- selbst wenn wir nicht dem überschwenglichen Urteil René Marcics[161] folgen wollen -- als das Zentrum der dem Staat aufgegebenen Einheitsbildung begreifen.
Wie ist dann erklärbar, daß das Bundesverfassungsgericht gerade in letzter Zeit arger Anfeindung unterlag -- und zwar nicht nur, wie sonst üblich, seitens der materiell informierten (d.h. von Fall zu Fall wechselnden) Gegnerschaft eines gefällten Urteils in seiner Substanz, sondern von weiten Teilen der Bevölkerung und des politischen Systems? Der kritische Verfassungsdiskurs hat sich beispiellos ausgeweitet[162], und das Ansehen des Bundesverfassungsgerichts in der Bevölkerung hat stark gelitten.[163] Es ist kaum plausibel, daß in letzter Zeit kontroversere oder schlechtere Urteile gefällt wurden als zuvor. Zwar wird wiederholt die Bündelung der Entscheidungen zur Anbringung von Kreuzen in staatlichen Pflichtschulen, die Entscheidung zur Meinungsfreiheit ("Soldaten sind Mörder"), die Nötigungs-Entscheidung und die iout of areai-Entscheidung angeführt, um beide Punkte -- gesteigerte politische Brisanz sowie Qualitätsverlust innerhalb kurzer Zeit -- zu belegen. Dies überzeugt jedoch nicht, zumal sich einerseits die jurstische Argumentationsführung nahtlos in die (gute) verfassungsgerichtliche Tradition einfügt, und auch vergangene Zeiten inhaltlich umstrittene und brisante Urteile erlebt haben.[164]
Nach dem bisher Gesagten wird die hier vertretene These nicht überraschen, daß die gesellschaftlichen Relativierungs- und Pluralisierungstendenzen nunmehr auch das bisher relativ gut abgeschirmte Bundesverfassungsgericht eingeholt haben. Es fällt ihm zunehmend schwerer, überzeugend die ihm aufgebürdete Rolle der deliberativen Integrationsinstanz zu spielen. Ich werde diese These im folgenden mit zwei Gedanken begründen. Zum einen fällt der Verfassungsdiskurs als solcher für die Stiftung von Einheit und Sinn zunehmend aus. Da dieser aber die einzige Quelle der verfassungsgerichtlichen Tätigkeit ist, muß die Institution selbst unter dem Zusammenbruch ihres Vehikels leiden. Zum zweiten soll der Rahmen etwas größer dergestalt abgesteckt werden, daß die herrschende deutsche Staatskonzeption als progressivistisch identifiziert wird und einem sich zunehmend emanzipierenden und auf Partizipation drängenden Demos gegenübergestellt wird.
Im allgemeinen wird fast einhellig angenommen, daß die Verfassung einen Grundkonsens im Gemeinwesen sicherstellt. Für Autoren, die Einheit auch woanders (wie etwa in der Moral oder der kulturell-ethnischen Homogenität) vermuten, ist dies die Rückfallposition; für Autoren, die dies nicht tun, die Ausgangsposition. Damit ist freilich noch nichts über das Verhältnis von Form und Substanz gesagt (ein Streit, der die US-amerikanische Verfassungstheorie paradigmatisch durchzieht und in immer neuen Gewändern auftaucht). So greift etwa Michael Perry im Rahmen seiner Konzeption von Verfassungsinterpretation auf "moral aspirations" des Volkes zurück[165], und auch viele andere Autoren befriedigen den Drang nach einer Begründung der Verfassungsgeltung durch eine Externalisierung der Legitimation.[166] Es bedarf keiner langatmigen Ausführungen, daß das Bundesverfassungsgericht auch die Grundrechte des Grundgesetzes in allgemeine Wertprogramme uminterpretiert hat. Dies hat eine Reihe von Konsequenzen: Zum einen wird (vor allem seit der sprachlichen Ablösung der "Werte" durch "Prinzipien") ein reiner Rechtsdiskurs ermöglicht, da eine unmittelbare Außenlegitimierung und somit etwa moralische Kommunikation vermieden wird; dies wiederum generiert kaum zu überschätzende Vorteile (dazu gleich). Zum zweiten leistete der Wertediskurs zweifellos für eine Zeitlang eine zumindest rhetorische Integration. Zum dritten schließlich ist diese Interpretation der Grundrechte -- vor allem im Zusammenhang mit dem flächendeckenden Verständnis der allgemeinen Handlungsfreiheit des Art. 2 Abs. 1 GG[167], mit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip sowie mit der objektiven Dimension der Grundrechte[168] -- für den enormen Machtzuwachs des Bundesverfassungsgerichts verantwortlich.[169]
Der Rechtsdiskurs, der in Wissenschaft wie Praxis zumeist als formalistischer geführt wird, hat Außerordentliches geleistet im Hinblick auf die Stabilisierung des Rechts, der Verfassungsgerichtsbarkeit und des Staates. Er soll im folgenden in bezug auf seine Form und auf seine Substanz näher beschrieben werden.
Formal fällt insbesondere auf, daß dem formalistischen Rechtsdiskurs die erste Person, sei sie Singular oder Plural, fast vollständig abhanden gekommen ist. Sowohl wissenschaftliche Aufsätze oder Monographien als auch Urteile werden unter häufiger Verwendung des Passiv und des Gerundium, durch Unausweichlichkeits-Semantiken und Automatismus-Rhetorik sowie unter geradezu inlationärer Personalisierung von Dingen und Konzepten abgefaßt. Dies dient dazu, das Subjekt des Autors des Rechtstextes zurücktreten zu lassen. Als Ersatz wird das Recht selbst als entweder transzendentes Objekt oder gar als transzendentes Subjekt in einer hochabstrakten und zugleich hochfiktiven Sprache behandelt. Der Grund dafür ist einfach: kein individuelles Subjekt -- keine Subjektivität. Das Recht wird als etwas Objektives begriffen, als etwas, was man durch Vernunft, Logik und Rationalität finden kann: eben als Wissen, und die Suche danach bezeichnet man als (Rechts-) Wissenschaft. Dem gleichen Ziel wie diese Ent-Subjektivierung dient die Ent-Historisierung des Rechts (z.B. durch Fortlassung der Jahreszahl, in dem eine Entscheidung eines Gerichts erlassen wurde, bei der Zitierung), die es in einen Zustand "permanenter Gegenwart" und insoweit allgemeiner Gültigkeit versetzt.[170]
Substantiell besteht der formalistische Rechtsdiskurs vor allem auf der Trennung von Recht und Politik.[171] Diese Systemgrenze dient vor allem dazu, die Integrität des Rechts zu bewahren[172]: Ist das Recht rational, ist die Politik irrational; ist das Recht "unbefleckt", ist die Politik "beschmutzt". Auch die Substanz zielt Autonomie und Objektivität des Rechts an. Im Zusammenwirken von Form und Substanz erkennen wir nun die große Konzeption, die dahintersteckt: Wahrheit.[173] James March und Johan Olsen prägen den treffenden Ausdruck des "myth of immaculate truth".[174] Sie weisen auch auf die stabilisierende Funktion des Wahrheitsmythos hin. Diese besteht zum einen darin, daß die Diskussion zivilisiert und das Potential für Konflikt, Konfrontation und Gewalt erheblich reduziert wird, indem die Sprache des Konflikts durch diejenige der wissenschaftlichen Untersuchung ersetzt wird. Niklas Luhmann stellt eben diesen Effekt fest, wenn er vor Kommunikation im moralischen System warnt (und dieses Anliegen funktionell der Ethik anträgt).[175] Dies ist insbesondere deshalb von außerordentlicher Wichtigkeit, weil gerade das Verfassungsrecht ständig Gefahr läuft, aufgrund der wertmäßigen und moralischen Aufladung der Verfassung in die Nähe moralischer Kommunikation zu geraten. Daneben gelingt es dem formalistischen Wahrheitsmythos-Diskurs, eine Verknüpfung mit dem Gerechtigkeitsideal herzustellen. Wissen und Recht geben vor, der Wahrheit zu dienen, nicht aber der Macht oder dem Mammon. Dadurch stellt das Recht eine Art Gegengewicht dar zur ungleichen und ungerechten Verteilung monetärer und sonstiger physischer Ressourcen.[176]
Darüber hinaus sorgt der Wertediskurs für die bereits oben angesprochene Entlastungsfunktion der Verfassung, die bestimmte Problemkreise regelt und sie damit vom Thema zur Prämisse der Politik werden läßt.[177] Dann kann es nur noch legitimerweise "zum Streit darüber kommen, was der verfassungsrechtliche Grundkonsens in einem konkreten Fall von den politischen Akteuren verlangt. Ein solcher Streit stellt nicht die Geltung der Verfassung in Frage, sondern bezieht sich auf das richtige Verständnis der - selbst unbestrittenen - Verfassung."[178] Ein solches Verständnis aber führt nur dann weiter, wenn man davon ausgeht, daß die Werteansammlung der Verfassung in sich Sinn macht. Gerade aber in dieser Hinsicht stellt sich die Frage, ob die Aufreihung allen Tugendhaften im Grundgesetz mit einem substantiellen Inhalt gefüllt ist, der Gegenstand eines Grundkonsenses sein könnte. Wir haben genau dieses Problem bereits oben im Rahmen des auf Ethos abzielenden autonomen Integration behandelt und dabei zweierlei feststellen können: Die Vielzahl von nebeneinander existierenden, häufig sehr allgemeinen und insofern manchmal nebulösen Werten, die nebenbei auch quantitativ nicht feststehen, so daß neue Werte hinzugefügt werden können, stellt ein erstes Problem dar. Wichtiger aber ist, daß diese Werte nicht hierarchisch geordnet sind und somit kollidieren. Hierfür aber gibt es lediglich am Einzelfall orientierte Lösungen. "Sie [die Werte] verlieren ihren direktiven Wert genau dann, wenn er benötigt wird."[179] Nun könnte eingewandt werden, daß dies eine Binsenweisheit sei, die den "Vätern" (und Müttern) des Grundgesetzes längst bekannt war, weshalb sie auch Vorkehrungen geschaffen haben: die Einrichtung des Bundesverfassungsgerichts. So argumentiert etwa Grimm:
"Bei der Verfassung mit ihren oft prinzipienhaft unscharfen Formulierungen und aus dem Einigungszwang von Gegnern erwachsenden Kompromißformeln und Lücken macht sich das [=die Unmöglichkeit, für jeden Fall eine unzweideutige Antwort bereitzuhalten] besonders bemerkbar. Zahlreiche Verfassungen sehen für einen solchen Konflikt keine spezielle Form der Auflösung vor. ... [D]as Grundgesetz [sieht] für Streitigkeiten über den Sinn der Verfassung eine eigene, der politischen Auseinandersetzung entrückte und unabhängig gestellte Instanz in Gestalt des Bundesverfassungsgerichts vor. Es ist die organisatorische Ausformung des Geltungsanspruchs der Verfassung."[180]
Dieser Gedanke basiert auf zwei Annahmen. Zum einen setzt er die integrierende Kraft eines der Politik entrückten Diskurses voraus. Dies gehört zwar heute noch immer zum Standard und lag insbesondere 1984 sicherlich nahe.[181] Seither sind jedoch, wie auch gerade gezeigt wurde, die Zweifel an wissenschaftlicher Rationalität, u.a. im juristischen Diskurs, insbesondere von Frankreich und den USA auch nach Deutschland gelangt.[182] Zum zweiten schlägt Grimm eine "organisatorische", mithin institutionelle Auflösung des Dilemmas vor. Dieser Vorschlag besticht, nehmen wir ihn in seiner Allgemeinheit. Wenden wir ihn jedoch auf unser konkretes Problem an, so zeigt sich, daß er mehr Probleme erzeugt als löst. Die Institution der Verfassungsgerichtsbarkeit ist es ja gerade, die die engagierte Diskussion ausgelöst hat, die in den USA unter dem Paradigma der "counter-majoritarian difficulty" gelaufen ist und noch läuft[183] und die mittlerweile auch in der Bundesrepublik wieder[184] auf einem hohen Niveau geführt wird. Kritik wird nicht etwa am formalistischen Diskurs geübt -- nein, vielmehr geht es ja gerade um die unzureichende demokratische Legitimation der Verfassungsgerichtsbarkeit. Hierin besteht, seitdem die scheinbare Losgelöstheit des Verfassungsgerichts von der politischen Sphäre an Überzeugungskraft verloren hat und dieses nicht mehr vor politischer Entmystifizierung und Deprofessionalisierung des Diskurses seitens der Gesellschaft (oder auch der Politik selbst) schützt, das große Manko des Bundesverfassungsgerichts. Die Probleme des Wertdiskurses haben über den Kollaps des "myth of immaculate truth", der dadurch mitverursacht wurde, zu unabsehbaren institutionellen Weiterungen geführt. Dagegen hilft auch der unmittelbar einsehbare funktionelle Hinweis kaum, daß man, ebensowenig wie man einen Bock zum Gärtner macht, eine demokratisch verantwortliche und damit auf Mehrheiten angewiesene Institution zum Hüter von Minderheitenrechten machen sollte. Er löst nämlich Fragen wie diejenige nicht, warum gerade Richter besonders zum Schutz dieser Rechte qualifiziert sein sollten. Damit versagt dann aber auch ein grundsätzlich verführerisches Konzept der Legitimation (oder: Konsens oder Einheit oder Integration) durch Verfahren. Die institutionellen Grundbedingungen des Verfassungsgerichts sind nicht ausreichend konsensumfaßt, so daß zwar das äußere Verfahren hingenommen und auch das Urteil zunächst akzeptiert werden kann, jedoch nur, um hinterher mit dem Hinweis auf die unzureichende demokratische Legitimation des Gerichts wieder fundamental in Frage gestellt zu werden. Und selbst wenn dies bestritten werden sollte, so steht doch fest, daß die "Anwendung" oder "Konkretisierung" des Verfassungsrechts durch das Bundesverfassungsgericht sich längst nicht mehr als rein objektiv-rationaler Vorgang darstellen läßt, sondern durch Subjektivität und richterliche Abwägung gekennzeichnet ist. Hier hat der Vorwurf, daß die Verfassungsrichter die Werte des Gesetzgebers durch ihre eigenen ersetzen, seinen wahren Kern -- und insoweit kann ebenfalls nicht von einem zumindest prozeduralen Konsens gesprochen werden. Nirgends als hier ist offenbarer, daß sich Substanz und Prozeß nur in den seltensten Fällen trennen lassen.[185]
Haben wir damit die eine Seite ausführlich betrachtet, soll sich unsere Aufmerksamkeit nunmehr gewissermaßen auf die andere Seite richten. Es wird zu zeigen sein, daß sich die Gesellschaft, als Volk verfaßt, aus der ihm zugedachten Rolle emanzipiert. Die Argumentation wird so verlaufen, daß zunächst die Konzeptionalisierung -- Progressivismus und Populismus -- kurz erläutert wird, und dann das deutsche Spannungsverhältnis dargelegt werden wird.
Populismus[186] fokussiert auf die Interessen der einfachen Bürger. Sein Mißtrauen richtet sich gegen große Organisationen und massive Bürokratie, mag sie nun öffentlicher oder privater Natur sein. Ebenso wird ein ungünstiges Licht auf Eliten und ihren Anspruch des besseren Urteils geworfen. Moralische oder politische Expertise wird mit Skepsis beäugt. Herrschaft hat eine private und eine öffentliche Seite: Zum einen existiert der Staat, um den einzelnen, seine Familie und seine ihn umgebende Gemeinschaft in die Lage zu versetzen, ein Leben in Würde und unbehelligt von der Macht öffentlicher oder privater Organisationen zu führen. Zum anderen verlangt Populismus, daß die Bürger ein Mitspracherecht in allen sie betreffenden Entscheidungen haben sowie an den Strukturen teilhaben können, die ihr tägliches Leben formen -- wenn sie sich für Partizipation entscheiden. Hieraus ergeben sich die von Jack Balkin formulierten Konsequenzen:
"[P]olitical participation is not something to be forced on the citizenry, nor are popular attitudes some sort of impure ore that must be carefully filtered, purified, and managed by a wise and knowing state. From a populist standpoint, such attempts at managerial purification are paternalistic. They typify elite disparagement and disrespect for popular attitudes and popular culture. Government should provide opportunities for popular participation when people seek it, and when they seek it, government should not attempt to divert or debilitate popular will."[187]
Demgegenüber liegt der Schwerpunkt des Progressivismus auf aufgeklärter Politik im öffentlichen Interesse. Danach ist der gut ausgebildete und zivilisierte einzelne durchaus in der Lage festzustellen, was das beste für das Interesse der Gesellschaft als ganzer ist. Überzeugung, Diskussion, Dialog, Deliberation -- all dies figuriert als Teil des gemeinsamen Ideologiesystems moderner demokratischer Gesellschaften, nämlich des Glaubens an Rationalität und Vernunft. Dagegen empfindet der Progressivismus solche Dinge wie "Volkszorn", "Volksempfinden" etc. als suspekt, da sie aller Wahrscheinlichkeit nach zu überhasteten und irrationalen Einschätzungen und Entscheidungen führen werden. Aus diesem Grund ist es wichtigste Aufgabe, den Bürger zu erziehen und alle uninformierten, möglicherweise gar passionierten Gefühle umzuleiten und abzuschwächen. Während der Populismus Machtkonzentration und -zentralisation (sei sie öffentlicher oder privater Art) als größte Bedrohung empfindet, liegen die Gefahren für demokratische Herrschaft aus der Sicht des Progressivismus in einer verengten Blickweise, in Ignoranz, in der Fixierung auf eigene Interessen, in uninformierter Selbstbezogenheit. Daher ist auch eine zentrale Autorität notwendig, um bestimmte Probleme zu lösen. Gleiches gilt für Expertenwissen:
"Far from being something to be distrusted, it [=expertise] is something to be particularly prized. Expertise is necessary to arrive at sound policy judgments; conversely, its lack often leads ordinary citizens to misunderstand the issues and make choices that are not in the public interest. Because of its respect for expertise, progressivism has always been quite comfortable with elite discourse, and progressivism is the natural home for reformers who are members of political, academic, and social elites."[188]
Der Vorzug der so definierten Perspektive liegt darin, daß sie unabhängig von der Grenzziehung zwischen politischen Parteien ist. Partizipation und Elitismus stehen quer zur rechts/links-Unterscheidung, und man findet sowohl Populismus als auch Progressivismus in allen politischen Lagern.[189] Insofern entzieht sich eine von der Populismus/Progressivismus-Unterscheidung der durch Traditionen, Emotionen und moralischen Überzeugungen gefärbten Kritik (partei-) politischer Parteinahme.
Verfassungsgefüge und -realität der Bundesrepublik sind klar progressivistisch ausgerichtet -- Karl Loewenstein sprach gar von der "offenkundigen Volksfeindlichkeit des Bonner Grundgesetzes".[190] Die Gründe hierfür mögen in unterschiedlichen Gegebenheiten liegen; unübersehbar jedoch spielte das Mißtrauen gegenüber dem demokratischen Vermögen des deutschen Volkes nach Weimar und der Zeit des Nationalsozialismus eine bedeutende Rolle.[191] Es kann keine große Verwunderung auslösen, daß dieses Verständnis nicht mehr den heutigen gesellschaftlichen Realitäten gerecht wird. Die Demokratie in Deutschland ist eine stabile, und das Volk -- zumindest im westlichen Teil Deutschlands -- hat über 50 Jahre lang demokratisches Bewußtsein sammeln und kultivieren können. So schließen Burns und van der Will ihren Beitrag u.a. mit den Worten, daß "there was no sign that the democratic foundations of West Germany had become insecure. Moreover, just as the democratic ethos had taken root, so the culture of that society had diversified."[192] Donald Kommers meint: "West Germany has developed into a durable democracy"[193]; andere Autoren schreiben:
"Die politische Kultur des heutigen Deutschlands ist zentral durch eines bestimmt: eine prinzipielle Akzeptanz der Demokratie, die - anders als in der Weimarer Republik - von keiner größeren politischen Gruppierung in Frage gestellt wird. ... Über das in den siebziger Jahren erreichte Maß hinaus finden auch demokratische Prinzipien wie Parteienkonkurrenz und Parlamentarismus Unterstützung."[194]
Obwohl Jürgen Habermas zur Vorsicht mahnt[195], will es auch nach der Vereinigung den Anschein haben, als ob die Demokratie in Deutschland gesellschaftlich fundiert ist. Dann ist es verständlich, daß der Demos an der Machtausübung auch unmittelbarere Teilhabe begehrt.[196] Die bereits erwähnten neuen sozialen Bewegungen sowie der Proteststurm nach der Kruzifix-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sind hierfür nur zwei von vielen Zeichen. Ein paternalistischer, erziehender, läuternder Staat ist hiermit nur schwer zu vereinbaren. Keinesfalls soll vorliegend einer ungehemmten Mehrheitsmacht das Wort geredet werden. Doch zeigt dieser knappe Überblick, daß nicht nur Auflösungstendenzen im "Staatsinnern" -- wie der Zusammenbruch der vormals integrierenden Diskurse --, sondern ebenso massive gesellschaftliche Veränderungen zum existierenden Spannungsverhältnis beitragen.
Aus dem bisher Gesagten wird deutlich, daß die Kritik am Bundesverfassungsgericht, die zur Zeit en vogue ist, kurzatmig ist und wichtige Umfeldbedingungen vernachlässigt. Vorwürfe, die sich auf eine nur unzureichende Integrations- und Streitschlichtungsleistung des Gerichts beziehen, verkennen den größeren Zusammenhang und greifen daher zu kurz. Ein allgemeiner Aufruf zu größerem Problembewußtsein und mehr Mut bei der Erfassung der gegenwärtigen Verfassungswirklichkeit aber wird der Problematik ebensowenig gerecht. Anspruchsvolle Programme und Konzeptionen zur Erfassung der Problematik von Verfassungsgerichtsbarkeit existieren durchaus, und bei weitem nicht nur in den USA. Auch transzendieren manche von ihnen die Sphäre der Verfassungsdogmatik und wenden sich stattdessen den gesellschaftlichen, funktionellen usw. Grundbedingungen zu, so daß der erhobene Vorwurf der Insulation und des Formalismus ganz und gar fernliegt. Jedoch wird ebenso deutlich, daß auch hier manches vorausgesetzt wird, was heute möglicherweise nicht mehr vorausgesetzt werden kann. Auch stellen sich gerade die Theorien, die auf den ersten Blick umfassend, fortschrittlich und eben progessiv erscheinen (und zweifellos auch so gemeint sind), zumeist als den Gefährdungen des Progressivismus erliegend heraus.
Als Beispiel sei ein Ausschnitt aus dem Werk Peter Häberles herangezogen. Sein 1978 gehaltener Vortrag über "Verfassungsgerichtsbarkeit als politische Kraft"[197] ist insoweit bemerkenswert, als er im zweiten Teil[198] einen verfassungstheoretischen Neuansatz ausbreitet. Häberle begreift die Verfassung als "rechtliche Grundordnung von Staat und Gesellschaft" und kann von daher postulieren: "Verfassungsgerichtsbarkeit als politische Kraft wirkt von vornherein jenseits des Trennungsdogmas Staat/Gesellschaft."[199] Vor dem Hintergrund der anfangs dargestellten, quasi Hegelschen Gegenüberstellung von Staat und Gesellschaft (supra II.), sowie eines zumeist formalistisch geführten Rechtsdiskurses (supra VII.) stellen sich diese Aussagen als hoffnungsvoller Schritt in die richtige Richtung dar. Häberles Konzeption des Bundesverfassungsgerichts ist diejenige eines "igesellschaftlichen Gericht[s]i eigener Art"[200], eines Gerichts, das in den gesellschaftlichen Bereich dadurch hineinragt, daß es sich einerseits für für die Vielfalt von Ideen und Interessen durch seine Rechtsprechung öffnet, und daß es andererseits die Gesellschaft steuert.[201] Die Funktion des Gerichts besteht nach Häberle darin, als Regulator in den kontinuierlichen Prozessen der Garantie und Fortschreibung der Verfassung als Gesellschaftsvertrag zu wirken: "Das BVerfG hat eine spezifische gesamthänderische Verantwortung in der Garantie und Fortschreibung der Verfassung als Gesellschaftsvertrag; es steuert ihre kontinuierlichen Prozesse mit; es ist dabei dem Pluralismusprinzip verpflichtet."[202] Die Leistungen hierbei bewertet Häberle durchaus positiv. Er bescheinigt "Fortschritt durch Verfassungsrichterrecht"[203] und meint, das Gericht habe "ein Stück ipolitischer Erziehungs- und Bildungsarbeiti par excellence geleistet."[204]
Soweit man Verfassungsrecht und -theorie nicht als sich innerhalb äußerst enggezogener "Grenzen intersubjektiver Nachprüfbarkeit" bewegend begreift[205], ist Häberles Ansatz innovativ, erfrischend und weitsichtig. Doch gelingt es auch ihm nicht, unserer Diagnose von den Schwierigkeiten gesellschaftlicher Repräsentation und Integration gerecht zu werden. Dies liegt insbesondere daran, daß er sich im Ergebnis -- z.T. explizit -- Rudolf Smends These von der Integrationskraft der Verfassung veschreibt.[206] Die Konzeption des Verfassungsgerichts als "gesellschaftliches Gericht" stützt die hier vorgetragene These, daß die gesellschaftliche Pluralisierung nunmehr auch diejenige Institution erreicht hat, die sich bisher als abgeschirmt betrachten und präsentieren konnte - das Bundesverfassungsgericht. Daß Häberle aber dennoch zu seiner erstaunlich optimistischen These gelangt, das Gericht komme einer ihm aufgetragenen "gesamthänderischen Verantwortung" erfolgreich (und den Fortschritt fördernd) nach, hängt mit einem recht utopischen Gesellschaftsbild zusammen. Die Gesellschaft sei pluralistisch und durch ganz und gar verschiedenartige Interessen, Wahrnehmungen, Überzeugungen etc. gekennzeichnet; dies wird zugestanden. Solchen Tendenzen stellt Häberle jedoch seine Idee der Verfassung als Gesellschaftsvertrag gegenüber. Hier offenbart sich, daß Häberle von einem "zahmen", oder negativ-scharf ausgedrückt, "naiven" Pluralismus ausgeht. Gleichzeitig wird seine stark progressivistisch ausgerichtete Grundhaltung sichtbar.
Die Idee der Verfassung als Gesellschaftsvertrag an sich wird von Häberle selbst als reines "Denkmodell" bezeichnet, das lediglich ein "heuristisches Prinzip zum Zweck der Verbürgung personaler Freiheit und öffentlicher Gerechtigkeit" darstellt.[207] Die Abstraktheit diese Modells bietet ihrem Schöpfer eine Reihe von Vorteilen. Zum einen gibt es dort, wo ein Vertrag existiert, auch eine Sphäre des gemeinsamen Interesses und, insgesamt, einen Konsens. Zivilrechtler wissen nicht nur zu berichten, daß der Vertragsschluß einen Konsens zwischen den Beteiligten voraussetzt, sondern auch, daß der gemeinsame Vertragszweck (und damit der Konsenskern) in vielen Fällen als Ausrichtung für die Interpretation und insoweit auch zur Streitschlichtung dient. Doch, so muß sich der imaginierte Häberlesche Verfassungs-Gesellschaftsvertrag fragen lassen, besteht denn jener Konsenskern realiter? Die Antworten -- personale Freiheit, öffentliche Gerechtigkeit, Gleichheit, Gemeinwohl -- können unsere Zweifel kaum verstummen lassen, da bereits oben die Schwächen der Werte-Antwort in ihrer Anwendung auf den konkreten Einzelfall deutlich gemacht wurde.
Zum anderen beleuchtet der Gesellschaftsvertrag im Sinne Häberles auch das progressivistische Verständnis der politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, ja gesellschaftlichen Prozesse. Die Pluralismuskonzeption, auf der das Häberlesche Werk beruht und die zunächst darauf hoffen läßt, daß progressivistischer Dirigismus zugunsten einer ernstgemeinten Einbeziehung des einzelnen und der Gruppen in den politischen Prozeß abgelöst werden könnte, entpuppt sich als im Grunde als Staatsaufgabe: staatlich gesteuerte, staatlich zu verwirklichende Verteilungsgerechtigkeit. Während die Gruppen möglicherweise von staatlichen Institutionen -- etwa dem Bundesverfassungsgericht -- im Rahmen derer Entscheidungsprozesse angehört werden, werden ihre Interessen vom Staat, so schlägt Häberle vor, auf der Basis eines fiktiven Gesellschaftsvertrages erkannt und durchgesetzt. Die Verfassung muß etwa so ausgelegt werden, "daß sich möglichst alle Bürger als solche verstanden fühlen"[208] -- eine nicht nur ganz und gar in mehr als einer Hinsicht utopische Vorstellung, sondern zugleich eine, die den Anspruch erhebt, erkennen zu können, wann sich ein Bürger verstanden fühlt und wann nicht. Die Offenheit des Staates wird insoweit nicht etwa durch die von mir in Andeutung vorgeschlagene Machtverschiebung vom Staat auf die Zivilgesellschaft gewährleistet[209], sondern erschöpft sich im wesentlichen darin, daß alle, auch benachteiligte Randgruppen, im Verteilungsprozeß angemessen und gerecht Berücksichtigung finden. Dies ist in der Bundesrepublik bereits Ausfluß der Grundrechte und des Sozialstaatsprinzips und vermag nicht viel zur Lösung des verfassungsgerichtlichen Legitimationsproblems beizutragen. Im Gegenteil - obwohl Häberle keinen locus deliberationis herausstreicht, sondern generell von verschränkter "Mitverantwortung" oder "Gesamtverantwortung" spricht[210], so beschwören seine Texte doch manche Ideen des in den USA nun hoch im Kurs stehenden "New Republicanism" herauf.[211] Dies wird etwa deutlich, wenn er sich auf den spezifischen, dem Bundesverfassungsgericht funktionellrechtlich zugewiesenen Platz bezieht, der diesem doch wieder "besondere Verantwortung" im Rahmen der "gesamthänderischen Verantwortung" aufgibt.[212]
Mögen diese Indizien noch als durchaus im Rahmen eines der Verfassungsgerichtsbarkeit als Institution per se innewohnenden, quasi natürlich-funktionellen Progressivismus angesehen werden, so scheint Häberle fast gezielt darauf hinzuarbeiten, als Progressivist par excellence eingeordnet zu werden. Aufschlußreich ist besonders der Glaube an Fortschritt und "Verbesserung" der Wirklichkeit, die durch Verfassungsrechtsprechung erreicht werden[213]; weiterhin sei auf das geläuterte und gehobene Kulturverständnis hingewiesen, das Häberle etwa dann bezeugt, wenn er nonchalant Namen wie Lessing, Schiller und Brecht fallen läßt.[214] Die klarste Sprache schließlich sprechen diejenigen Passagen seines Werkes, die die erzieherische Aufgabe der Verfassung und insbesondere der Verfassungsgerichtsbarkeit hervorheben und positiv beurteilen.
"Das BVerfG hat igrundrechtspolitischi, aber auch iföderalistischi ... ein Stück ipolitischer Erziehungs- und Bildungsarbeiti par excellence geleistet (iVerfassungspädagogiki, Verfassungssätze ialsi Erziehungsziele). Gerade wenn sich politische Kultur (wie iKulturstaatlichkeiti) nicht von heute auf morgen ieinpflanzeni läßt, kommt in diesem langsamen Wachstumsprozeß -- er ist ein solcher der Verfassung -- der Verfassungsgerichtsbarkeit eine zentrale Rolle zu."[215]
Häberle ist ohne weiteres darin zuzustimmen, daß sich demokratisches Bewußtsein erst in einem nicht zu kurzen Prozeß erlebend und erlernend bilden muß. Das Mißtrauen gegenüber dem deutschen Demos der zu gründenden Bundesrepublik war -- dies wurde bereits erwähnt -- nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus, der Weimarer Republik und dem Kaiserreich berechtigt. Insoweit war Progressivismus (unter starker Betonung der erzieherischen Komponente) zweifellos angebracht. Jeder Erziehungsauftrag aber hat mit einem inhärenten Paradoxon zurechtzukommen: Erfolg setzt dem Unternehmen ein Ende. Der Versuch, dem erwachsengewordenen und nunmehr selbstverantwortlichen Kind weitere erzieherische Lehren zu erteilen, ist überflüssig, wirkt unwürdig und wird auf Widerstände treffen. Nichts anderes gilt in bezug auf das deutsche Volk und sein Verhältnis zum filternden, läuternden und weiterhin erziehenden Staat. Während das, was man zynisch "Unmündigkeitsvermutung" nennen könnte[216], bisher eine funktionierende progressivistische Legitimationsbasis für das Bundesverfassungsgericht darstellen konnte, verliert diese zunehmend an Plausibilität: Einige wenige Stimmen aus dem großen Chor derjenigen, die den deutschen Demos für demokratisch maturiert halten, wurden bereits oben angeführt.[217] Die ablehnende Reaktion des Erziehungs-"Subjekts" hat nicht lange auf sich warten lassen und manifestiert sich unübersehbar in den Widerständen etwa gegen die Urteile zum Schwangerschaftsabbruch (II) und zum Anbringen von Kreuzen und Kruzifixen in öffentlichen Schulen. Dagegen läßt sich auch nicht anführen, daß nach Häberle der Staat seine Erziehungsziele in Form von "Angeboten" umsetzt, die er dem Bürger macht und die dieser annehmen oder zurückweisen kann.[218] Wenn dem so wäre, so würde dies in der Tat dem privaten Aspekt des Populismus Rechnung tragen, der darin besteht, daß der Bürger die Wahl hat, ob und wie er partizpieren (und eben auch: sich kultivieren) will. Jedoch ist es in diesem Zusammenhang hilfreich, sich die Einsicht Robert Covers in Erinnerung zu rufen, mit der dieser die unumschränkte Vergleichbarkeit literarischer und rechtlicher Interpretation zurückgewiesen hat: "Legal interpretation takes place in a field of pain and death."[219] Hat er mit dieser Aussage selbst ein Stück Literatur geschrieben, so ist der hier relevante Punkt, daß die Rechtsinterpretation, im Gegensatz zur literarischen, durch Sanktionen durchgesetzt werden kann.[220] So liegt es auch in bezug auf das Verfassungsgericht: Entscheidungen aus Karlsruhe sind nicht einfach "Angebote" des Staates an den Bürger. Sie prägen und gestalten die Rechtswirklichkeit, sie sprechen Ge- und Verbote aus, die jeweils durch Zwang vollzogen werden können.[221]
Ein weiteres Beispiel für anspruchsvolle Verfassungsgerichtsbarkeits-Theorie bildet etwa die bedeutende Schrift Ingwer Ebsens, die, auf dem pluralistischen Ansatz aufbauend, einen eindrucksvollen, differenzierten Entwurf zur Legitimität der Verfassungsgerichtsbarkeit vorstellt.[222] Von Häberle unterscheidet Ebsen zum einen die größere (begriffliche) Präzision[223], zum anderen eine durchgehend spürbare größere Nüchternheit. Nach dem Ebsenschen Modell ist die Verfassungsgerichtsbarkeit im demokratischen Verfassungsstaat mit drei Aufgaben betraut:
"(1) Wahrung der Offenheit des politischen Prozesses, die die Legitimität des Mehrheitsprinzips voraussetzt;
(2) Sicherung des gesellschaftlich konsentierten Maßes an Individualschutz gegenüber staatlicher Macht;
(3) Integration der partikularen Interessen in solchem Maße, daß das auf Mehrheitsentscheidung basierende Legalitätssystem möglich bleibt."[224]
Alle drei Aufgaben sind zu einem bestimmten Grad auf Konsens bezogen. So gilt nach Ebsen:
ad (1): "Die Funktion der Offenhaltung des politischen Prozesses gründet sich auf einen Konsens auf einer Metaebene zu derjenigen der Gestaltung der Lebensverhältnisse, nämlich auf der Ebene des politischen Prozesses selbst, in welchem die Gestaltungen der Lebensverhältnisse konflikthaft zustandegekommene iResultanteni sind."
ad (3): "[D]er Konsens, den die Integrationsfunktion einerseits voraussetzt und auf dessen Bewahrung sie andererseits gerichtet ist, betrifft eine weitere, von konkreten Gestaltungen noch weiter abgehobene Metaebene, indem er sich gar nicht auf Normen bezieht, sondern lediglich auf das Ziel, unter der iregulativen Idee des Gemeinwohlsi (Fraenkel) den in der Verfassungsgebung stattgefundenen isozialen Kompromißi zu bewahren und zu aktualisieren."
ad (2): "[D]ie normative Funktion der Freiheitssicherung durch Verfassungsgerichtsbarkeit [ist] genau auf die Elemente des umfassenden Freiheitsbegriffs zu beziehen, die im Prinzip - d.h. abgesehen von Randproblemen - von materiellem Verfassungskonsens getragen sind."[225]
Meine Kritik richtet sich nicht gegen die Idee, daß bestimmte Dinge
-- Konzepte, Normen, Werte -- in unserer Gesellschaft konsensumfaßt sein könnten. Es mag durchaus der Fall sein, daß etwa, wie Ebsen schreibt, der Grundsatz der Bekenntnisfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 und 2 GG zu den "von faktischem Verfassungskonsens getragenen Elemente[n] ifreiheitlicheri Rechtsstaatlichkeit" zu zählen ist.[226] Dies jedoch ändert nichts daran, daß eben dieser Grundsatz für viele Menschen viel Unterschiedliches bedeutet, und daß allein die Tatsache, daß die Bekenntnisfreiheit verfassungsrechtlich normiert ist, noch lange nicht heißt, daß dieser Themenbereich dem politischen Prozeß entzogen, geschweige denn materiell konsensumfaßt ist. Gehört die ungehinderte Religionsausübung tatsächlich zu einem "als unverzichtbar konsentierten Freiheitsbereich"[227]? Die Probleme liegen darin begründet, daß es im Einzelfall notwendigerweise zu Definitionsfragen und Abwägungen kommen wird. Der Leser wird bereits des bloßen Hinweises auf das sog. Kruzifix-Urteil und dessen anschließende Diskussion nicht bedürfen. Ebsen klammert dies durch seinen Parenthese-Zusatz ("d.h. abgesehen von Randbereichen") aus. Hierauf genau kommt es aber an. Zweifellos ist es möglich, durch die Produktion immer allgemeiner werdender Formulierungen Zustimmung zu erlangen, die man als Konsens bezeichnen kann. Diese Strategie aber muß dann versagen, wenn es auf ihr Funktionieren ankäme: im Falle von Einzelfällen, in denen die Abstraktionsebene zur Lösung verringert werden muß. Es handelt sich um die Problematik des Wertediskurses. Gleiches läßt sich in bezug auf das Zielprogramm der Offenhaltung des politischen Prozesses festhalten.
Die dritte und abstrakteste Zielfunktion der Verfassungsgerichtsbarkeit -- die "Integrationsfunktion" --, die Ebsen unter dem Schlagwort der "Verfassung als sozialer Kompromiß" listet[228], schließlich bezieht sich deutlich auf die Gesellschaftsvertragsversion Häberles.[229] Ebsen versteht das Ziel der Integration als ein verfahrensmäßiges, das sich gegenüber den anderen beiden durch "strukturell angelegte größere Inhaltsärme" auszeichnet.[230] Wer jedoch nun an Luhmanns "Legitimation durch Verfahren" denkt, täuscht sich. Vielmehr scheint angesichts des Fehlens von noch so vagen Verfassungsprinzipien eine gemeinwohlorientierte Rhetorisierung angezielt:
"[Der Unterschied zu den anderen, vorgenannten Funktionen besteht darin,] daß die beiden auf inhaltliche Ziele gerichteten Funktionen weitgehend auf materiellen Konsens gestützt werden können, während die Integrationsfunktion die Aufgabe bedeutet, im inhaltlichen Konflikt den Konsens über die Legitimität seines Austrags einschließlich des Ergebnisses zu wahren und zu verstärken. ... Insoweit, als die Verfassung als isozialer Kompromißi noch nicht festliegt, sondern erst in der Verfassungsrechtsprechung punktuell festgelegt wird, besteht die Integrationsfunktion der Verfassungsgerichtsbarkeit darin, für den iKampf um Verfassungspositioneni (Seifert) den subjektiven Handlungssinn des Ringens unter der regulativen Idee des Gemeinwohls zu verstärken und den Sinn als Kampf zu reduzieren."[231]
Ebsens Vorstellung von der verfassungsgerichtlichen Integrationsfunktion stellt sich insoweit als zwiespältig dar. Hervozuheben ist einerseits, daß Verfassungsgerichtsbarkeit z.T. als "Prozeß der Entscheidung offener Verfassungsfragen"[232] erkannt und benannt wird. Andererseits aber meint sich Ebsen verpflichtet zu fühlen, diese Funktion auf die Unterscheidung zwischen "sich konflikthaft entwickelndem Prozeß" und "selbstregulierendem System" zurückführen zu müssen[233] -- eine Unterscheidung, die geradewegs auf derjenigen zwischen kontroversem und nicht-kontroversem Sektor der Fraenkelschen Pluralismustheorie aufbaut.[234] Damit muß sich Ebsens Fundament die gleichen Fragen gefallen lassen, die wir oben (v.a. III.) im Hinblick auf den "underlying consensus" gestellt haben. Sehr deutlich wird die Überbetonung des gesellschaftlichen konsensualen Raumes, wenn Ebsen schreibt:
"Umgekehrt wäre eine wesentliche tatsächliche Prämisse des Modells idemokratischer Verfassungsstaati in Frage gestellt, wenn Jörg Paul Müllers wohl nicht nur auf die Schweiz bezogene Aussage zuträfe, wir lebten in einer iauch im Wertbewußtsein nicht nur pluralistischen, sondern bis zur Kommunikationsunfähigkeit gespaltenen Gesellschafti."[235]
Darüber hinaus scheint sich Ebsens Hoffnung, diesen Fragen durch die Betonung des Prozeßhaften jener Funktion die Spitze zu nehmen, nicht zu erfüllen. Dies liegt daran, daß sich die Differenz von "process" und "substance", um auf die ausführliche US-amerikanische Debatte anzuspielen[236], auf der von Ebsen angezielten Ebene kaum durchhalten läßt. Zum einen sieht er selbst das Ziel darin, "die Verfassung so auszulegen, daß die verschiedenen sozialen Interessen in für die faktische Legitimation der Herrschaftsordnung hinreichender Weise Berücksichtigung finden"[237], womit inhaltlich-substantielle Leitlinien vorgegeben sind. Zum anderen ist auch Ebsens verfahrensmäßige "Befriedungs"-Konzeption fragwürdig. Die Tatsache, daß ein bundesverfassungsgerichtliches Urteil ergeht, bedeutet noch lange nicht, daß damit Konsens erreicht ist, selbst wenn die unterlegene Partei das Urteil "annimmt".[238] Die amerikanische Reaktion auf das Urteil des Supreme Court zum Schwangerschaftsabbruch, Roe v. Wade[239], lehrt uns, daß die Möglichkeit des Gegenteils besteht[240], und spätestens seit der Diskussion des Kruzifix-Urteils wissen wir auch um die Realität dieser Möglichkeit in Deutschland.
Hieraus wird deutlich, daß auch so ausdifferenzierte Theorien der Verfassungsgerichtsbarkeit wie die pluralistische aufgrund ihrer Konsensvorstellungen den Kern des Problems verfehlen. Den sich mitunter im Ton vergreifenden Kritikern der letzten Urteile aber ist zuzurufen: Es liegt nicht am Bundesverfassungsgericht! Es geht um viel mehr, nämlich darum, daß die "Vertextung des Staates ihr Ende erreicht" hat.[241] Es hat den Anschein, als ob die dreistufige Entwicklung des Legitimationsdenkens, die Klaus von Beyme als (1) die Suche nach dem guten Staat durch die Prämoderne, (2) die Suche nach dem legitimen Staat durch die Moderne, und (3) die Beschränkung auf Legitimation durch Verfahren in der Postmoderne vorstellt[242], in eine Phase der "post-posthistoire" getreten ist: des Verlustes des staatlichen Vermögens zur Integration, und hierzu gehört auch, mit Einschränkungen, im Wege des Verfahrens. Die Gesellschaft verfügt über keine zentrale Instanz mehr, die in der Lage wäre, das Ganze zu integrieren.
Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, sich dies vorzustellen. Helmut Willke, systemtheoretisch argumentierend, etwa schlägt vor, die einzelnen funktionalen Systeme mit der Last zu betrauen: Es liege "an den differenzierten Funktionssystemen, selbst die erforderlichen Vorleistungen für die Möglichkeit der Integration des Gesellschaftssystems zu erbringen".[243] Helmut Dubiel macht aus der Not eine Tugend und benutzt das Medium des Konflikts, um einen integrierenden symbolischen Raum zu erzeugen:
"Demokratische Gesellschaften erhalten sich eben nicht dadurch, daß konfligierende Gruppen ihre interessenbedingt unversöhnlichen Orientierungen einem imaginären Konsens aufopfern. Vielmehr bilden sie ihr symbolisch integrierendes Kapital gerade im Prozeß solcher strukturell bedingter Konfrontationen aus. Eine in ihren Legitimationsgrundlagen umfassend säkularisierte Gesellschaft kann sich zu sich selbst einzig in der Form von Konflikten in Beziehung setzen. Wenn die Rede von einer kollektiven Identität ... überhaupt Sinn macht, dann ist der politische Konflikt das Medium, in dem sich diese Identität ... herausbildet. ... [I]n dem Maße, wie sich die politischen Akteure über die Zielsetzung ihrer Gesellschaft streiten, betätigen sie sich auch als Mitglieder ein und derselben Gemeinschaft. Durch den Konflikt hindurch begründen sie ohne Aufgabe ihrer Gegnerschaft einen sie zugleich integrierenden symbolischen Raum."[244]
Es soll aber nicht Aufgabe des vorliegenden Beitrages sein, subsystemische oder symbolische Integration zu imaginieren; der Hinweis darauf, daß das Problem erkannt und an möglichen Alternativen abgearbeitet wird, soll genügen. Indessen hoffen die Ausführungen gezeigt zu haben, daß weder die bisher geübte politische noch juristische Kritik am Bundesverfassungsgericht der Komplexität des Integrationsproblems gerecht wird. Sie setzt durchgehend ein "holistisches" Gesellschaftskonzept voraus, das von den Nachbarwissenschaften -- etwa in kommunikationstheoretischer Perpektive durch den Begriff der "Lebenswelt", aus systemtheoretischer Sicht, wie gezeigt, unter dem Paradigma der "ausdifferenzierten Gesellschaft" ohnehin[245] -- als illusionär erkannt wird. Isensee kommt dem Ist-Zustand recht nahe, wenn er schreibt, daß die staatliche Einheit "nicht auf politischem, sozialem, ökonomischem, kulturellem Konsens [gründet]".[246] Dies ist genau zutreffend. Dann jedoch schreckt er zurück und gründet eben jene Einheit auf "der allgemeinen Freiheit, die dem Dissens legitimen Raum gibt".[247] Hört sich dies zunächst wie ein Paradox an, wird es aber unmittelbar verständlich unter Berücksichtigung des Konzepts der Freiheit durch den Staat, das wiederum einerseits auf dem schroffen Hegelschen Dualismus fußt, andererseits von einem integrationsfähigen Staat ausgeht. Gerade dieses Verständnis aber ist es, das heute der Erosion preisgegeben ist. Die pluralisierte Gesellschaft will ihre Präferenzen nicht mehr extern geläutert wissen, und der Staat kann dies nicht ohnehin nicht mehr leisten. Populare Energie widersetzt sich progressivistischer Belehrung und drängt nach ungefilterter Freisetzung. Das Konzept der staatlichen Konfliktneutralität, das uns bei weitem nicht nur Isensee[248] anbietet, wird als Rhetorik durchschaut, die dann, wenn es auf ihr Funktionieren ankäme, versagt; die bisher so bewährte Mechanik der "Rechtsfindung", der deduktiven Fallösung, überzeugt in einer Zeit, die die Sprache und ihre Zeichen als fundamental uneindeutig erkannt hat, nicht mehr.
Es geht in dem vorliegenden Beitrag auch nicht darum, über Konsenstheorien der Wahrheit oder über die Notwendigkeit von Konsens für sinnvolle Kommunikation zu streiten. Dies wird von anderen auf einem höheren Niveau getan, als es mir möglich wäre.[249] Stattdessen erschöpft sich mein Anliegen darin, das fragwürdige Vorverständnis derjenigen Kritiken des Bundesverfassungsgerichts zu beleuchten, die von Karlsruhe noch immer eine umfassende gesellschaftliche Integration erwarten. Dieser Anspruch wird als unrealistisch und kurzsichtig abgelehnt. Darüber hinaus erweist sich ein solcher Anspruch auch als dysfunktional, da er den Blick verstellt für Aufgaben, die die Verfassungsgerichtsbarkeit unter den heutigen Umständen realistisch erfüllen könnte. Es werden insofern akademische Ressourcen verbraucht, die besser in das Projekt investiert würden, worin eine solche angemessene Aufgabe bestehen könnte. Das Beharren auf einer Rückführung verfassungsrechtlicher Streitschlichtung auf einen konsensumfaßten Kern gesamtgesellschaftlicher Integration führt da nicht weiter. Es scheint mir vielmehr an der Zeit, mit den Folgen gesellschaftlicher Pluralisierung ernst zu machen, das Unternehmen "Integration durch Verfassung (und Verfassungsgerichtsbarkeit)" aufzugeben und stattdessen der pluralisierten Gesellschaft selbst einen angemessenen Platz im politischen Prozeß einzuräumen. Dies mag dazu beitragen, eben diesem Prozeß und damit auch seinen Resultaten zu höherer Legitimation zu verhelfen. Erwägenswert ist insofern etwa das Zugeständnis einer größeren Rolle für die gereifte deutsche Zivilgesellschaft. Weiterhin erwägenswert ist darüber hinaus, ob dies nicht den Weg dafür freimachen könnte, Pluralismus -- anstatt auf Umwegen im Bundesverfassungsgericht -- in der Gesellschaft selbst zu verorten und zu belassen, und im Gegenzug die Institution der Verfassungsgerichtsbarkeit klarer als icountermajoritarian forcei zu sehen und als solche zu akzeptieren.
Dies mag sein wie es will. Jedenfalls aber ist der Rechtswissenschaft anzuraten, hier und dort die Erkenntnisse der Nachbarwissenschaften zu berücksichtigen, um nicht, ohne es zu wollen, in den Theoriebereich der kleinstmöglichen Reichweite zu geraten. Weit weniger als für die Praxis[250] trifft dies für die Wissenschaft vom Recht zu, und hier insbesondere die Verfassungstheorie. Dies gilt auch dann, wenn jene Erkenntnisse im wesentlichen das bekannte Dilemma verdeutlichen: "Das Alte geht nicht mehr, aber das Neue geht auch noch nicht."
Das Bundesverfassungsgericht sieht sich scharfen Angriffen seitens der Öffentlichkeit und der Wissenschaft mit dem Argument ausgesetzt, es versage bei der Erfüllung seiner Aufgabe der Streitschlichtung und Integration. Der vorliegende Beitrag entlarvt diese Kritik als auf unerfüllbaren Erwartungen fußend.
Die spezifisch deutsche Ausprägung des Neo-Pluralismus hat die Frage danach, warum sich die Mitglieder eines Gemeinwesens überhaupt zusammentun und dem Mehrheitsprinzip unterwerfen (in Deutschland wird dies meistens allein aus der Perspektive des Gemeinwohls gesehen), dem Staat überantwortet. Der von einem sittlichen Staat gemanagte consensus omnium aber ist inhaltlich leer: Weder Kultur noch Religion noch Geschichte noch Sprache noch Nation vermögen substantiell zu integrieren. Die bisher funktionierende Rhetorik der Integration erodiert in gleichem Maße angesichts der zunehmenden gesellschaftlichen Pluralisierung: Die "Vertextung des Staates" ist am Ende. Dies haben zunächst die politischen Parteien, dann staatliche Institutionen wie Parlament und Regierung zu spüren bekommen. Da auch (und gerade) die Verfassung dieser Diagnose unterfällt, erfährt nunmehr das Bundesverfassungsgericht, das die Verfassung als Substanz und Medium seiner Kommunikation benutzt, die Konsequenzen dieser Tendenz. Die Verfassungstheorie - auch die pluralistische - hat bisher die Folgerungen aus dieser Diagnose nicht gezogen.
The German Federal Constitutional Court is subjected to sharp attacks from the public and from the academia, who reproach the Court for failing to fulfill its functions: dispute settlement and integration. In this article, I argue that this critique is built on unrealistic and exaggerated expectations.
One of the core questions of democratic theory is why members of a polity form a community and subject themselves to the principle of decision-making by majority vote. Germany, with its peculiar form of neo-pluralism, has turned to the state as an answer. However, the "underlying consensus" managed by an ethical State has no substance. Neither culture, religion, history, language nor the concept of nationhood allow for substantial integration. Just as the pluralization of society is growing, the hitherto functioning rhetoric of integration is eroding. The "textualization of the State" has come to an end. The consequences first hit the political parties, then Parliament and the Government. The integrative power of the Constitution has sharply deteriorated as well, recently sending the Federal Constitutional Court, which uses the Constitution as its substance and communicative medium, into a similar tailspin. Constitutional theory - even that which goes under the label "pluralist" - has not yet been able or willing to acknowledge the consequences.