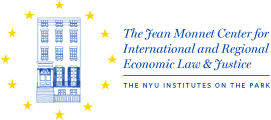
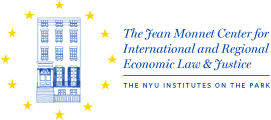 |
[1] Visiting Researcher, European Law Research Center, Harvard University, Cambridge (Mass.), USA. Soweit englische Zitate übersetzt sind, stammen die Übersetzungen von mir (falls nicht anderweitig vermerkt). Ich danke den Professoren Dieter Grimm und Peter Häberle für hilfreiche Anmerkungen zu früheren Entwürfen. Professor Knut Ipsen danke ich für seine stete Förderung. Ohne die Unterstützung durch Professor Joseph Weiler wäre dieser Beitrag nicht entstanden - mein Dank gilt in erster Linie ihm.
[2] Beobachtungen der Moderne, Opladen 1992, Vorwort, S. 7.
[3] My UniversityÕs Yacht: Morality and the Rule of Law, in: Ian Shapiro (Hrsg.), The Rule of Law, Nomos XXXVI, New York/London 1994, S. 205 ff. (212 f.).
[4] Als Beispiele neueren deutschsprachigen Schrifttums seien nur genannt Bernhard Peters, Die Integration moderner Gesellschaften, Frankfurt/M. 1993; Erwin Teufel (Hrsg.), Was hält die moderne Gesellschaft zusammen?, Frankfurt/M. 1996; Helmut Dubiel, Metamorphosen der Zivilgesellschaft II: Das ethische Minimum der Demokratie, in: ders., Ungewißheit und Politik, Frankfurt/M. 1994, S. 106 ff.; Jürgen Gebhardt/Rainer Schmalz-Bruns (Hrsg.), Demokratie, Verfassung und Nation. Die politische Integration moderner Gesellschaften, Baden-Baden 1994; Ulrich K. Preuß (Hrsg.), Zum Begriff der Verfassung. Die Ordnung des Politischen, Frankfurt/M. 1994; Günter Frankenberg (Hrsg.), Auf der Suche nach der gerechten Gesellschaft, Frankfurt/M. 1994; Bert van den Brink/Willem van Reijen (Hrsg.), Bürgergesellschaft, Recht und Demokratie, Frankfurt/M. 1995; Rainer Forst, Kontexte der Gerechtigkeit. Politische Philosophie jenseits von Liberalismus und Kommunitarismus, Frankfurt/M. 1994, insbes. S. 143 ff. Das Problem der Integration und der Repräsentation der modernen Gesellschaft liegt m.E. im Kern der heutigen politisch-wissenschaftlichen Diskussion, so daß mehr oder minder direkt fast alle zeitgenössischen Beiträge damit zu tun haben. Eine auch nur halbwegs repräsentative Aufzählung kann daher nicht geleistet werden. Erwähnung finden sollen aber noch die einflußreichen Abhandlungen von John Rawls, Der Gedanke eines übergreifenden Konsenses, sowie ders., Der Bereich des Politischen und der Gedanke eines übergreifenden Konsenses, beide in: ders., Die Idee des politischen Liberalismus, Aufsätze 1978-1989, Frankfurt/M. 1992, S. 293 ff. bzw. S. 333 ff.
[5] Etwa Verfassung und Verfassungsrecht, München/Leipzig 1928, abgedruckt in ders., Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze, 3. Aufl., Berlin 1994, S. 119 ff.
[6] Roland Barthes, Myth Today, in: ders., Mythodologies, New York 1972, S. 109 ff. Unter ÒMythosÓ ist danach eine Sprechweise, ein Kommunikationssystem, mithin eine Form zu verstehen. Das Prinzip des Mythos ist es, Geschichte in Natur zu verwandeln (ibid., S. 129). Barthes bezeichnet die im Text genannte Aufgabe des Mythos als Zaubertrick, der Realität umstülpt, da diese von Geschichte entleert und stattdessen mit Natur gefüllt werde (ibid., S. 142). Anders ausgedrückt: Mythos (als entpolitisiertes Sprechen) streitet Dinge nicht ab, im Gegenteil, seine Funktion liegt gerade in ihrer Thematisierung; er läutert sie, läßt sie unschuldig werden, und gibt ihnen Klarheit, die nicht etwa diejenige einer Erklärung, sondern die einer Tatsachenfeststellung ist (ibid., S. 143). Den Zusammenhang zwischen Mythen, symbolischer Politik und politischer Kultur stellt nunmehr etwa Ansreas Dörner, Politischer Mythos und symbolische Politik, Reinbek bei Hamburg 1996, dar.
[7] Zuletzt etwa Gounalakis, NJW 1996, S. 481 ff., der in seiner Rezension der beiden ÒSoldaten sind MörderÓ-Entscheidungen (BVerfG NJW 1994, 2943 und NJW 1995, 3303) zu dem Schluß gelangt, dem Bundesverfassungsgericht sei die allseits erwartete Konfliktschlichtung mißglückt. Dezidiert anders etwa Dieter Grimm, Interview mit der Süddeutschen Zeitung, SZ vom 9.12.1995: "Die Aufgabe des Verfassungsgerichts besteht nicht in der Friedensstiftung, sondern in der Durchsetzung der Verfassung. Wenn seine Entscheidungen den gesellschaftlichen Frieden wiederherstellen, ist das ein beglückendes Ergebnis, über das man froh sein darf."
[8] So der sehr treffende Ausdruck von Niklas Luhmann, Metamorphosen des Staates, in: ders., Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Bd. 4, Frankfurt/M. 1995, S. 101 ff. (114).
[9] Winfried Brugger, Radikaler und geläuterter Pluralismus, Der Staat 29 (1990), 497 ff. (501).
[10] The Federalist No. 10 (hrsgg. von Jacob E. Cooke, Middletown [Conn.] 1961).
[11] Vgl. etwa Manfred G. Schmidt, Demokratietheorien, Opladen 1995, S. 151; ähnlich, allerdings mit subtilen -- aber, wie noch zu sehen sein wird, entscheidenden -- Abschwächungen Winfried Brugger,Radikaler und geläuterter Pluralismus (Anm. 9), S. 500, der von ÒGegensatz zum isolierten IndividualismusÓ (anstatt Anti-Liberalismus) und einer Wendung gegen "überzogene Ansprüche staatlicher Souveränität" (anstatt Anti-Etatismus) spricht.
[12] Franz Lehner, Ideologie und Wirklichkeit. Anmerkungen zur Pluralismusdiskussion in der Bundesrepublik, Der Staat 24 (1985), S. 91 ff. (99).
[13] David Held, Models of Democracy, Stanford (Cal.) 1987, S. 201.
[14] Vgl. Robert A. Dahl, A Preface to Democratic Theory, Chicago/London 1956.
[15] Ders., A Preface to Economic Democracy, Cambridge (Mass.) 1985, etwa S. 162.
[16] Alexander von Brünneck, Nachwort: Leben und Werk von Ernst Fraenkel (1898-1975), in: Ernst Fraenkel, Deutschland und die westlichen Demokratien, erw. Aufl. Frankfurt/M. 1991, S. 360 ff. (369).
[17] Ernst Fraenkel, Strukturanalyse der modernen Demokratie, in: ders., Deutschland und die westlichen Demokratien (Anm. 16) S. 326 ff. (358 f.) (meine Hervorhebungen).
[18] Seymour Martin Lipset, Political Man, New York 1963, S. 32 Anm. 20.
[19] Ernst Fraenkel, Der Pluralismus als Strukturelement der freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie, in: ders., Deutschland und die westlichen Demokratien (Anm. 16), S. 297 ff. (314).
[20] Manfred G. Schmidt, Demokratietheorien (Anm. 11), S. 151.
[21] Winfried Brugger, Radikaler und geläuterter Pluralismus (Anm. 9), S. 516 ff.
[22] Vgl. hierzu (und zur Verteidigung des Liberalismus) etwa Stephen Holmes, The Anatomy of Antiliberalism, Cambridge (Mass.)/London 1993, der seinen liberalen Zorn kaum zurückhalten kann. Brugger ist zugute zu halten, daß er wohl sieht, daß es nicht nur auf das ÒisolierteÓ, sondern auch das ÒassoziierteÓ Individuum ankommt im Pluralismus-Diskurs. Jedoch: "Die Mitmenschen, mit denen man assoziiert ist, sind demgemäß auch primär als Mittel zum Zweck der Beförderung der eigenen Ziele einzustufen. Es mag zwar sein, daß ein Individuum in seine Zwecksetzungen altruistische Motive einbezieht, aber auch das steht in der freien Wahl des Menschen." Brugger, ibid., S. 516.
[23] Klaus von Beyme, Interessengruppen in der Demokratie, 5. Aufl. 1980, S. 15, bzw. Martin Kriele, Einführung in die Staatslehre, Opladen 1975, S. 179 (beide zitiert bei Brugger [Anm. 9], S. 504).
[24] David Held, Models of Democracy (Anm. 13), S. 190 bzw. 192 mit Verweis auf Robert A. Dahl, Who Governs?, Democracy and Power in an American City, 1961. Der Staat werde sogar ununterscheidbar vom Hin und Her des ständigen Verhandelns und sei am besten konzipiert als lediglich eine weitere Interessengruppe: Held, ibid., S. 190. Ebenso Benjamin R. Barber, Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age, Berkeley et al. 1984, S. 143: Ò[P]luralist democracy resolves public conflict in the absence of an independent ground through bargaining and exchange among free and equal individuals and groups, which pursue their private interests in a market setting governed by the social contract."
[25] Ernst Fraenkel, Historische Vorbelastungen des deutschen Parlamentarismus, in: ders., Deutschland und die westlichen Demokratien (Anm. 16), S. 23 ff. (34) (meine Hervorhebungen). Das Zitat von von Beyme oben bei Anm. 23.
[26] Alexander von Brünneck, Nachwort (Anm. 16), S. 368 mit umfangreichen Nachweisen.
[27] Kurt Sontheimer, Grundzüge des politischen Systems der neuen Bundesrepublik Deutschland, Neuausgabe München 1993, S. 160 f. Sontheimer bezieht sich ausdrücklich auf Hegel und Òseine zahlreichen EpigonenÓ. M.E. läßt sich Sontheimer von der Rhetorik des deutschen Neo-Pluralismus und seiner Vermischung mit Liberalismus einfangen, wenn er am Ende des Abschnittes über die etatistische Tradition abwiegelt: ÒDiese [etatistische] Tradition ist nach 1949 jedoch nicht mehr wirklich mächtig geworden. ... [F]aktisch hat sich das pluralistische System der Parteien und Interessenverbände -- den modernen Triebkräften der politischen Willensbildung -- voll durchgesetzt." Auch Sontheimers abschließendes Lob für die Politikwissenschaft vermag den nicht zu überzeugen, der Franz Lehners Beitrag in der Zeitschrift "Der Staat" kennt (Anm. 12): "Die deutsche Politische Wissenschaft hat einiges zum theoretischen Verständnis des modernen Demokratiemodells beigetragen."
[28] Hans Lietzmann, Staatswissenschaftliche Abendröte. Zur Renaissance der Staatsorientierung in Deutschland, in: Jürgen Gebhardt/Rainer Schmalz-Bruns (Hrsg.), Demokratie, Verfassung und Nation (Anm. 4), S. 72 ff. Von einer "neoetatistischen Morgenröte" spricht dagegen Helmuth Schultze-Fielitz, Staatszwecke im Verfassungsstaat - 40 Jahre Grundgesetz. Eine Nachbetrachtung zur Staatsrechtslehrertagung 1989, Staatswissenschaften und Staatspraxis 1990, 228 ff. Vgl. dazu auch Gunnar Folke Schuppert, Diskurse über Staat und Verwaltung, Staatswissenschaften und Staatspraxis 1991, 122 ff.; ders., Rigidität und Flexibilität von Verfassungsrecht. Überlegungen zur Steuerungsfunktion von Verfassungsrecht in normalen wie in "schwierigen Zeiten", AöR Bd. 120 (1995), 32 ff., alle mit umfangr. Nachw. auf weiteres Schrifttum.
[29] Klaus von Beyme, Theorie der Politik im 20. Jahrhundert. Von der Moderne zur Postmoderne, Frankfurt/M. 1991, S. 130.
[30] Benjamin R. Barber, Strong Democracy (Anm. 24), S. 21.
[32] Wobei es, so der Historiker Bracher, selbstverständlich nicht ausreichend ist, "allgemein über den Charakter des deutschen Volkes zu räsonieren und in einem historischen Streifzug von Luther über Bismarck bis Hitler die Anfälligkeit für Diktatur und Untertanengesinnung zu entdecken." Karl Dietrich Bracher, Die Auflösung der ersten deutschen Demokratie, in: ders., Wendezeiten der Geschichte: Historisch-politische Essays, München 1995, S. 121 ff. (121). Daß Fraenkel durch die Erfahrungen kommunistischer und nationalsozialistischer Art sowie durch das Scheitern der Weimarer Demokratie einerseits und durch die Lebensfähigkeit angloamerikanischer Demokratien andererseits geprägt ist, betont Manfred G. Schmidt, Demokratietheorien (Anm. 11), S. 156 f.
[33] Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (neu hrsgg. Frankfurt/M. 1970), ß 182 (S. 339). Vgl. auch weiter die Charakterisierung der bürgerlichen Gesellschaft in den ßß 188 ff, insbesondere das ÒSystem der BedürfnisseÓ (ßß 189 ff., S. 346 ff.): Danach konstituiert sich der gesellschaftliche Zusammenhang als dialektische Bewegung gegeneinander gerichteter Interessen.
[36] Hierdurch wird der Staat Adressat eines Verschaffungsanspruches. Vgl. statt aller Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die sozialen Grundrechte im Verfassungsgefüge, in: ders., Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zur Verfassungstheorie und zum Verfassungsrecht, Frankfurt/M. 1991, S. 146 ff.; ders., Freiheit und Recht, Freiheit und Staat, in: ders., Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte, Frankfurt/M. 1991, S. 42 ff.; Dieter Grimm, Der Staat in der kontinentaleuropäischen Tradition, in: ders., Recht und Staat der bürgerlichen Gesellschaft, Frankfurt/M. 1987, S. 53 ff.
[37] Vgl. aber etwa BVerfGE 83, 37 (51 ff.) - Ausländerwahlrecht; BVerfGE 83, 60 (71 ff.) - Bezirksvertretung Hamburg.
[38] BVerfGE 89, 155 (185) (meine Hervorhebung).
[39] Vgl. einerseits etwa Josef Isensee, Abschied der Demokratie vom Demos. Ausländerwahlrecht als Identitätsfrage für Volk, Demokratie und Verfassung, in: Dieter Schwab/Dieter Giesen/Joseph Listl/Hans-Wolfgang Strätz (Hrsg.), Staat, Kirche, Wissenschaft in einer pluralistischen Gesellschaft. Festschrift für Paul Mikat, 1989, S. 705 ff.; Paul Kirchhof, Der deutsche Staat im Prozeß der europäischen Integration, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland Bd. VII, Heidelberg 1992, S. 855 ff.; andererseits etwa J.H.H. Weiler, Der Staat "über alles" - Demos, Telos und die Maastricht-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, JöR N.F. Bd. 44 (1996), S. 91 ff. (erschienen auf englisch als The State "über alles" - Demos, Telos and the German Maastricht Decision, in: Ole Due/Marcus Lutter/Jürgen Schwarze [Hrsg.], Festschrift für Ulrich Everling, Baden-Baden 1995, S. 1651 ff.); Brun-Otto Bryde, Die bundesrepublikanische Volksdemokratie als Irrweg der Demokratietheorie, Staatswissenschaften und Staatspraxis 1994, S. 305 ff.; auch ders., Verfassunggebende Gewalt des Volkes und Verfassungsänderung im deutschen Staatsrecht: Zwischen Überforderung und Unterforderung der Volkssouveränität, in: Roland Bieber/Pierre Widmer (Hrsg.), L'espace constitutionnel européen, Zürich 1995, S. 329 ff.
[40] Erhoben von J.H.H. Weiler, ibid. Diese Außerachtlassung soll nicht bedeuten, daß der Vorwurf von der Hand zu weisen ist. Nur geht es mir im vorliegenden Zusammenhang nicht hierum, sondern ausschließlich um die Leistungskraft des pluralistischen consensus omnium.
[41] BVerfGE 89, 155 (185) - Maastricht.
[42] Robert A. Dahl, A Preface to Democratic Theory (Anm. 14), S. 132. Man beachte, daß der Konsens hier nicht nur, wie das Bundesverfassungsgericht meint, vor-rechtlich, sondern ebenso vor-politisch gedacht wird.
[43] Statt vieler Nachweise nur Ernst Fraenkel, Deutschland und die westlichen Demokratien, in: ders., Deutschland und die westlichen Demokratien (Anm. 16), S. 48 ff. (66); ders., Demokratie und öffentliche Meinung, in: ders., ibid., S. 232 ff. (246 ff.).
[44] Ernst Fraenkel, Demokratie und öffentliche Meinung (Anm. 43), S. 246.
[45] Winfried Brugger, Radikaler und geläuterter Pluralismus (Anm. 9), S. 507.
[46] Als caveat: Ich bin mir bewußt, daß auch das, was ich autonome Integration nennen werde, auf Abgrenzung und Unterscheidung beruht. Wenn ich mich etwa auf meine Geschichte als das mich Definierende berufe, so sage ich zugleich, daß die Geschichte von anderen eben nicht die meinige und anders ist. Der Philosoph Wilhelm Schmid geht sogar so weit, jegliche Identitätskonzeption als problematisch zu empfinden, "[w]eil der, der von Identität spricht, als nächstes von dem spricht, was nicht identisch mit ihm ist. ... Identität ist per definitionem der Ausschluß des Anderen, in jedem Fall aber dessen 'Aufhebung'." (Wilhelm Schmid, Brauchen wir eine neue "nationale Identität"? - Gesellschaft, Nation und Nationalismus in der Gegenwart, in: Siegfried Unseld [Hrsg.], Politik ohne Projekt? Nachdenken über Deutschland, Frankfurt/M. 1993, S. 133 ff. [336].) Dies scheint mir über das Ziel hinausgeschossen zu sein. Abgrenzung ist nicht etwas per se Schlechtes, und bei weitem nicht nur die Systemtheorie belehrt uns, daß Grenzziehungen notwendig und unerläßlich sind. Was mich (um auf meinen Ausgangspunkt zurückzukommen) zur Aufrechterhaltung meiner Einteilung zwischen autonomer und heteronomer Integration veranlaßt, ist ein immerhin gradueller Unterschied. Es kann die Priorität auf der Abgrenzung liegen (etwa beim Anti-Kommunismus) -- dann ist Schwerpunkt die Heteronomie. Die Priorität kann aber auch auf dem aus dem Inneren Gewachsenen liegen (etwa der eigenen Geschichte) -- dann sehe ich den Schwerpunkt im Autonomen.
[47] Ulrich Beck, Die Erfindung des Politischen. Zu einer Theorie reflexiver Modernisierung, Frankfurt/M. 1993, S. 132 f. (Hervorhebungen im Original).
[48] Vgl. ausführlich Dietrich Tränhardt, Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, erw. Neuausgabe Frankfurt/M. 1996, S. 30 ff.
[49] Der nachfaschistische Konsens wird hier als Grenzgänger zwischen heteronomer und autonomer Integration verstanden, dazu noch weiter unten im Rahmen der autonomen Integration. Zu den verschiedenen Ausprägungen und Umgangsformen (etwa Italien, Österreich, Deutschland) vgl. nur Helmut Dubiel, Deutsche Vergangenheiten, in: Siegfried Unseld (Hrsg.), Politik ohne Projekt? (Anm. 46), S. 236 ff.
[50] Ulrich Beck, Die Erfindung des Politischen (Anm. 47), S. 132 f. Es handelt sich hierbei natürlich nicht um eine neue Erkenntnis, sondern um eine uralte Weisheit. Historiker reden in bezug auf dieses Phänomen gern vom ablenkenden ÒPrimat der Außenpolitik".
[51] Ibid., S. 110 ff.; dort auch zur Idee der Nation, zu Enzensbergers Òterritorialem InstinktÓ, zur Enttraditionalisierung des Fremden (und des Eigenen) und zur gefährlichen Dezision der Grenzziehung.
[52] J.H.H. Weiler, Europa am Fin de siécle - Über Ideale und Ideologie im Europa nach Maastricht, Zeitschrift für Schweizerisches Recht. N.F. Bd. 112 (1993), S. 437 ff. (439); der überarbeitete englische Originaltext nunmehr als Europe After Maastricht - Do the New Clothes Have an Emperor?, Harvard Jean Monnet Working Paper 12/95 (1995).
[53] Hierauf spielt Weiler mit Òvorgetäuscht, entlarvt und zersetztÓ an; ibid.
[54] Dies gilt ohnehin nur für kollektive Ideale. In bezug auf individuelle Ideale (ebenso wie individuelle Spiritualität usw.) kann man genau das Gegenteil feststellen. Das Verlangen nach Transzendenz und Spiritualität in einer technisierten, szientisierten Welt wird -- dies ist keineswegs eine Neuigkeit -- immer größer.
[56] Vgl. Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt M. 1986.
[57] Hierzu nur Niklas Luhmann, Soziologie des Risikos, Berlin 1991.
[59] Von dem -- im Konjunktiv -- Ulrich Beck spricht, vgl. Die Erfindung des Politischen (Anm. 47), S. 146.
[60] Vgl. ders., ibid., S. 144 ff. Aus systemtheoretischer Sicht kritisch Niklas Luhmann, Ökologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?, Opladen 1986. Davon, daß Ökologie auch umfangreiches elitistisches Potential birgt, legt der Beitrag von Heinz Theisen, Zukunftsvorsorge als Staatsaufgabe, Staatswissenschaften und Staatspraxis 1995, 111 ff., beredtes Zeugnis ab.
[61] Le Postmoderne expliquÈ aux enfants, Paris 1988, Kap. 4.
[62] Etwa La condition postmoderne: Rapports sur le savoir, Paris 1979.
[63] So versucht etwa Habermas darzulegen, daß kohärente Epistemologie möglich ist, und daß hieraus verallgemeinerungsfähiges Wissen über soziales Leben und soziale Entwicklungen extrahierbar ist (Jürgen Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt/M. 1985). Auch Giddens schreibt nach eigener Aussage gegen Lyotards Diagnose an: Anthony Giddens, Consequences of Modernity, Stanford (Cal.) 1990, S. 2 ff.
[64] J.H.H. Weiler, Europa am Fin de siécle (Anm. 52), S. 448. Weilers Fokus auf substantieller Integration darf nicht verwundern, bezeichnet er sich doch selbst - augenzwinkernd - an einer Stelle als Òprae-modernÓ: J.H.H. Weiler, The Constitution of Europe: Do the New Clothes Have an Emperor? and Other Essays on the Ends and Means of European Integration, Cambridge (Engl.) 1996, im Druck, Preface.
[65] Z.B. Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in: ders., Recht, Staat, Freiheit (Anm. 36), S. 92 ff.; vgl. auch die Beiträge in Dieter Grimm, Recht und Staat der bürgerlichen Gesellschaft (Anm. 36). M.E. haben sich hier insbesondere systemtheoretische Analysen verdient gemacht. Vgl. etwa Niklas Luhmann, Selbstlegitimation des Staates, in: Norbert Achterberg/Werner Krawietz (Hrsg.), Legitimation des modernen Staates, ARSP Beiheft 15, Wiesbaden 1981, S. 65 ff.; ders., Staat und Staatsräson im Übergang von traditionaler Herrschaft zu moderner Politik, in: ders., Gesellschaftsstruktur und Semantik, Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Bd. 3, Frankfurt/M. 1989, S. 65 ff.
[66] Stephen Holmes, Gag Rules or the Politics of Omission, in: Jon Elster/Runde Slagstad (Hrsg.), Constitutionalism and Democracy, Cambridge (Engl.) 1988, S. 19 ff.
[67] Vgl. etwa Dieter Grimm, Die Zukunft der Verfassung, in: ders., Die Zukunft der Verfassung, Frankfurt/M. 1991, S. 397 ff. (425 ff.); ders., Verfassung, in: ders., ibid., S. 11 ff. (15 ff.).
[68] So etwa Cass R. Sunstein, Constitutions and Democracies: An Epilogue, in: Jon Elster/Rune Slagstad (Anm. 66), S. 327 ff. (340).
[69] Ibid., mit Verweis auf Hannah Arendt, On Revolution, New York 1965, und Roberto M. Unger, Politics: A Work in Constructive Social Theory, Cambridge (Engl.) 1987. Die deutsche Demokratie kann hier stolz auf die parlamentarische und außerparlamentarische Diskussion der Reform des § 218 StGB (Schwangerschaftsabbruch) verweisen.
[70] Auch das Argument, daß sich der christliche heute in einen abendländisch-kulturellen Konsens verwandelt habe, wie dies vor allem in der Diskussion der Kruzifix-Entscheidung behauptet wurde, vermag nicht zu tragen, wie die sich hieran anschließende kontroverse Diskussion gezeigt hat (vgl. nur die Beiträge von Hans Schueler und Robert Leicht in Die Zeit v. 18.8.1995, S. 1, sowie von Eberhard Jüngel, FAZ v. 14.9.1995, S. 41, und Hans Maier, FAZ v. 20.9.1995, S. 39). Zu Integration durch Kultur vgl. unten Text bei Anm. 87 ff.
[71] Vgl. Niklas Luhmann, Ethik als Reflexionstheorie der Moral, in: ders., Gesellschaftsstruktur und Semantik Bd. 3 (Anm. 65), S. 358 ff. (364): ÒHochkulturen sind in diesem Sinne moralisch integrierte Gesellschaften, und ihre Religionen können sich nicht von Moral distanzieren.Ó
[72] Der Leser wird hier unschwer die Sprache und Konzeption des (ÒfrühenÓ) Luhmann wiedererkennen, etwa Rechtssoziologie (1972), 3. Aufl., Opladen 1987, S. 27. Im folgenden Abschnitt über die Integrationsfähigkeit von Moral wird an vielen Stellen auf das (nunmehr autopoietisch angereicherte) Gedankengut Luhmanns zurückgegriffen. Vgl. insbesondere Niklas Luhmann, The Morality of Risk and the Risk of Morality, 3 International Review of Sociology 87 (1987); ders., The Code of the Moral, 14 Cardozo Law Review 995 (1993); ders., Paradigm Lost: Über die ethische Reflexion der Moral (Rede anläßlich der Verleihung des Hegel-Preises 1989), Frankfurt/M. 1990, S. 7 ff.; ders., Ethik als Reflexionstheorie der Moral (Anm. 71); ders., Soziologie der Moral, in: ders./Stephan H. Pfürtner (Hrsg.), Theorietechnik und Moral, Frankfurt/M. 1978, S. 8-116; ders., Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt/M. 1984, S. 317 ff.
[73] Niklas Luhmann, Ethik als Reflexionstheorie der Moral (Anm. 71), S. 367 f.
[74] Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt/M. 1993, S. 78. Vgl. hierzu auch neuestens die Beiträge in Kurt Bayertz (Hrsg.), Moralischer Konsens. Technische Eingriffe in die menschliche Fortpflanzung als Modellfall, Frankfurt/M. 1996.
[75] Niklas Luhmann, The Code of the Moral (Anm. 72), S. 1008.
[76] Weitere Beispiele ibid., S. 1004 f.
[77] Luhmann weist darauf hin, daß damit nicht bestritten wird, daß Òein gewisses Maß an Begründungskonvergenz (ein ëethisches MinimumÕ des Rechts) immer gegeben ist.Ó Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft (Anm. 74), S. 79 in Fußnote 71.
[78] Etwa Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge (Mass.) 1978 (dt. als Bürgerrechte ernst genommen, Frankfurt/M. 1984); ders., Law's Empire, Cambridge (Mass.) 1986; ders., A Matter of Principle, Cambridge (Mass.) 1985.
[79] Ingeborg Maus, Die Trennung von Recht und Moral als Begrenzung des Rechts, Rechtstheorie 20 (1989), 191 ff.; wieder abgedruckt in dies., Zur Aufklärung der Demokratietheorie. Rechts- und demokratietheoretische Überlegungen im Anschluß an Kant, Frankfurt/M. 1992, S. 308 ff. (336).
[80] Niklas Luhmann, Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?, Heidelberg 1993, S. 19.
[81] Um noch einmal den Zusammenhang zwischen Identität und der normativen Ebene zu verdeutlichen: Gruppenidentität, so können wir aus sozialpsychologischen Studien lernen, wird zur kognitiven und motivatorischen Basis für die Ausformung von Verhalten und Auffassungen. Vgl. etwa Nachw. bei James G. March/Johan P. Olsen, Democratic Governance, New York 1995, S. 74 f.
[82] Niklas Luhmann, Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen? (Anm. 80), S. 18.
[83] Es seien nur in zufälliger Auswahl ein paar genannt: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Frieden, Sicherheit, Würde, Wohlfahrt, Solidarität. Schon allein eine solche Aufzählung macht manches deutlich; erstens die Tatsache, daß manche Werte sich mit anderen nicht gerade optimal vertragen, sondern in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander stehen (Freiheit - Gleichheit); zweitens die Tatsache, daß diese Werte wiederum ausfüllungsbedürftig sind -- was häufig wiederum unter Rückgriff auf Werte geschieht. So vertritt etwa Paul Kirchhof folgende Auffassung von Freiheit: "[D]ie Rechtsgemeinschaft [muß] gewährleisten, daß die Menschen die Fähigkeit zur Freiheit entwickeln und ausbilden. Die innere Selbstbindung in Rechtschaffenheit, Redlichkeit und Verläßlichkeit, die Achtung vor Person und Ehre, das Verbot sittenwidriger Schädigung oder die Lauterkeit des Wettbewerbs sind nur gesichert, wenn die Bürger ihre Freiheit in einer gefestigten Kulturordnung erleben, ihr Alltag sittlich geprägt ist, Bürgerstolz und Gemeinsinn in dieser Gebundenheit wurzeln." (Paul Kirchhof, Woran das Bundesverfassungsgericht gebunden ist, FAZ v. 13.9.1995.) Der Leser sei dazu ermuntert, das Zitat wiederholt und langsam im Hinblick auf Ausfüllungsbedürftigkeit zu lesen.
[84] Etwa Niklas Luhmann, Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen? (Anm. 80), S. 18 f.; ders., Das Recht der Gesellschaft (Anm. 74), S. 96 f. Vgl. dazu auch ders., Grundwerte als Zivilreligion, Archivio di Filosofia 1978, No. 1-2, S. 51 ff. Diese Kritik ist weder neu noch spezifisch systemtheoretischer Natur.So schreibt etwa Ely unter der Überschrift "Discovering Fundamental Values -- Consensus":"Thus when one gets down to cases, one finds ... a mix of the uselessly general and the controversially specific." John Hart Ely, Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review, Cambridge (Mass.)/London 1980, S. 64.
[85] Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, 2. Aufl., Berlin 1926, S. 14.
[86] Dies macht unmißverständlich deutlich -- in bezug auf das Verhältnis zwischen Autorität und diskursiver Gemeinschaft (die vorliegend als ein Ausdruck der zentrifugalen Bewegung verstanden wird) -- Paul W. Kahn, Legitimacy and History: Self-Government in American Constitutional Theory, New Haven/London 1992, v.a. S. 210 ff.
[87] Die Debatte um Kulturstaatlichkeit ist im rechtswissenschaftlichen Schrifttum schon häufiger geführt worden. Gute Überblicke vermitteln etwa die Beiträge in Peter Häberle (Hrsg.), Kulturstaatlichkeit und Kulturverfassungsrecht, Darmstadt 1982, sowie die Beiträge von Udo Steiner und Dieter Grimm zu dem Thema Kulturauftrag im staatlichen Gemeinwesen, VVDStRL 42 (1983).
[88] So etwa Godfrey Carr/Georgia Paul, Unification and Its Aftermath: The Challenge of History, in: Rob Burns (Hrsg.), German Cultural Studies, Oxford 1995, S. 325 ff. (335).
[90] 2 Bde., Frankfurt/M. 1983.
[91] Vgl. auch Rob Burns/Wilfried van der Will, The Federal Republic 1968 to 1990: From the Industrial Society to the Culture Society, in: Rob Burns (Hrsg.) (Anm. 88), S. 257 ff. (291).
[92] Jürgen Habermas, Die neue Intimität zwischen Kultur und Politik, in: ders., Die nachholende Revolution, Frankfurt/M. 1990.
[93] Ibid. Bemerkt sei, daß Habermas sich hiermit weit von den Thesen der Horkheimerschen und Adornoschen Frankfurter Schule entfernt, die behauptete, die Kulturindustrie sei ein manipulatives Instrument der Wirtschaftsinteressen und der herrschenden Klasse.
[94] Z.B. Günter Grass, Gegen die verstreichende Zeit. Reden, Aufsätze und Gespräche 1989-1991, Hamburg/Zürich 1991.
[95] Etwa Ulrich Greiner, Die Zeit vom 2.11.1990, S. 59 f.
[96] Es soll nicht verschwiegen werden, daß es sich hierbei um einen Terminus (ebenso wie eine Konstruktion) handelt, die Vico und Herder verpflichtet ist. Vgl. hierzu nur Isaiah Berlin, The Crooked Timber of Humanity, New York 1991, v.a. S. 49 ff. und 70 ff. Berlin grenzt den Begriff außerdem von Òkulturellem RelativismusÓ ab. Zur Konzeption von kulturellem Pluralismus als utopischer Auflösung eines ethnisch definierten Nationalismus vgl. Wolfgang Kaschuba, Nationalismus und Ethnozentrismus. Zur kulturellen Ausgrenzung ethnischer Gruppen in (deutscher) Geschichte und Gegenwart, in: Michael Jeismann/Henning Ritter (Hrsg.), Grenzfälle. Über neuen und alten Nationalismus, Leipzig 1993, S. 239 ff.
[97] Vgl. hierzu etwa die Beiträge in Symposium: Law and Popular Culture, 10 Canadian Journal of Law and Society 1 (1995); Symposium: Popular Legal Culture, 98 Yale Law Journal 1545 (1989); David L. Gunn (Hrsg.), The Lawyer and Popular Culture: Proceedings of a Conference, Littleton 1993; Naomi Mezey, Legal Radicals in Madonna's Closet: The Influence of Identity Politics, Popular Culture, and a New Generation on Critical Legal Studies, 46 Stanford Law Review 1835 (1994).
[99] Und dies ganz unabhängig davon, ob das ÒernsthafteÓ Kunstwerk explizit ÒpopulistischÓ sein will, wie etwa im Falle des späteren Werkes Hans Werner Henzes, der in seinem Essay ÒExkurs über den PopulismusÓ von 1979 ankündigt, das "Ghetto der Moderne" zu verlassen.
[100] So etwa vertont der populäre Hit der Sängerin Cheryl Crow ÒAll I Wanna DoÓ ein Gedicht von Professor Wyn Cooper vom Bennington College, das in einem Band veröffentlicht war, der weniger als 500 mal verkauft wurde. (Vgl. J.M. Balkin, Populism and Progressivism as Constitutional Categories, 104 Yale Law Journal 1935 [1995], S. 1990 in Fußnote 188.) Ein anderes Beispiel, in dem nicht nur ëZutatenÕ und Endprodukt aus vermeintlich unterschiedlichen Regionen der kulturellen Ernsthaftigkeit stammen, sondern in dem das Gesamtwerk selbst die Grenze verwischt, sind etwa Andrew Lloyd Webbers Musicals.
[101] Für eine solche Attacke vgl. den für Deliberation und Òcivic republicanismÓ streitenden Cass R. Sunstein, Democracy and the Problem of Free Speech, New York et al. 1993.
[102] Obwohl eine erste Intuition für die Möglichkeit und Berechtigung einer solchen Kritik spricht, wird man auf den zweiten Blick doch sehr nachdenklich (Gegenargumente etwa bei J.M. Balkin, Populism and Progressivism as Constitutional Categories [Anm. 100]). Auf diesen Punkt wird noch zurückzukommen sein: vgl. unten Anmerkung 214 in Kritik an Häberle.
[103] Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986), S. 196. In Bowers, v. Hardwick war der Supreme Court mit der Frage sexueller Selbstbestimmung konfrontiert und muþte ¸ber eine Norm entscheiden, die ÒSodomieÓ (definiert als Òany sexual act involving the sex organs of one person and the mouth or anus of anotherÓ, also auch Oralverkehr) verbot. Die Mehrheit der Richter (5:4) lehnte ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ab. Die Entscheidung hat eine wahre Literaturflut ausgelöst; es soll gen¸gen, f¸r das deutsche Schrifttum auf die knappe Stellungnahme Bruggers hinzuweisen: Winfried Brugger, Einf¸hrung in das öffentliche Recht der USA, M¸nchen 1993, S. 110 f.; ders., Persönlichkeitsentfaltung als Grundwert der amerikanischen Verfassung - Dargestellt am Beispiel des Streits um den Schutz von Abtreibung und Homosexualität, Heidelberg 1994, S. 41 ff.
[104] Vgl. etwa J.M. Balkin, Tradition, Betrayal, and the Politics of Deconstruction, 11 Cardozo Law Review 1613 (1990).
[105] Niklas Luhmann, Kultur als historischer Begriff, in: ders., Gesellschaftsstruktur und Semantik Bd. 4 (Anm. 8), S. 31 ff. (48 bzw. 51) (Anmerkung von mir weggelassen, Hervorhebungen von mir hinzugefügt).
[106] Rob Burns/Wilfried van der Will, The Federal Republic 1968 to 1990: From the Industrial Society to the Culture Society (Anm. 91), S. 322.
[107] Um nur einige wenige Beiträge zu nennen: Eric J. Hobsbawm, Nationen und Nationalismus - Mythos und Realität seit 1870, Frankfurt/M. 1990; Bernhard Giesen (Hrsg.), Nationale und kulturelle Identität, Frankfurt/M. 1991; B. Estel, Grundaspekte der Nation, Soziale Welt 29 (1991), 208 ff.; Alois Hahn, Identität und Nation in Europa, Berliner Journal für Soziologie 1993, 193 ff.; Michael Jeismann/Henning Ritter (Hrsg.), Grenzfälle (Anm. 96); Jürgen Habermas, Staatsbürgerschaft und nationale Identität (1990), in: ders., Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt/M. 1992, S. 632 ff.; M. Rainer Lepsius, "Ethnos" oder "Demos" - Zur Anwendung zweier Kategorien von Emerich Francis auf das nationale Selbstverständnis der Bundesrepublik und auf die europäische Einigung, in: ders., Interessen, Ideen und Institutionen, Opladen 1990, S. 247 ff.; Ulrich Beck, Die Erfindung des Politischen (Anm. 47), S. 110 ff.; Dieter Langewiesche, Reich, Nation und Staat in der jüngeren deutschen Geschichte, Historische Zeitschrift Bd. 254 (1992), 341 ff.
[108] Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Nation: Identität in Differenz, Politische Wissenschaft 1995, S. 974 ff. (978 mit Verweis auf Ivan Katsarski, On the Nature and Origin of the Nation, Ms.).
[109] In der Nähe dieser Definition liegt die Aussage, die Nation stelle Òhistorisch kontingent eine Weise dar[], in der sich Staaten selbst beschreibenÓ; so Manfred Lauermann, Der Nationalstaat - Ein Oxymoron, in: Jürgen Gebhardt/Rainer Schmalz-Bruns (Hrsg.), Demokratie, Verfassung und Nation (Anm. 4), S. 33 ff. (35). Historische (sowie m.E. räumliche) Kontingenz trifft ins Schwarze; ob es sich jedoch um eine Selbstbeschreibung des Staates handelt, mag in dieser Allgemeinheit bezweifelt werden.
[110] Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Nation (Anm. 108), S. 975 und 981 f.
[114] Vgl. nur etwa Manfred Frank, Nachdenken über Deutschland - Aus Anlaß der Kommemoration der Reichspogromnacht vom 9. November 1939, in: Siegfried Unseld (Hrsg.), Politik ohne Projekt? (Anm. 46), S. 250 ff. (261 f.). Allerdings könnte man durchaus fragen, ob es sich tatsächlich um eine autonome oder nicht doch eher eine heteronome Integrationsbewegung gehandelt hat. Hierauf deuten etwa die schaurigen Verse Heinrich von Kleists und Ernst Moritz Arndts hin (Kleist: "Schlagt sie [die Franzosen] tot, das Weltgericht / Fragt euch nach den Gründen nicht" [Germania an ihre Kinder]; Arndt: "Das ist des Deutschen Vaterland, / Wo Zorn vertilgt den welschen Tand, / Wo jeder Franzmann heißet Feind, / Wo jeder Deutsche heißet Freund." [Des Deutschen Vaterland].) Brubaker vertritt gar, daß die ethno-kulturelle Konzeption des Nation-Begriffs im Grundgesetz nachgewiesen werden kann: Rogers Brubaker, Einwanderung und Nationalstaat in Frankreich und in Deutschland, Der Staat 28 (1989), 1 ff. (15).
[115] Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Nation (Anm. 108), S. 984.
[116] Allerdings -- dies sei hervorgehoben -- ignoriert Böckenförde die Gefahren und Konsequenzen eines ethnisch grundierten Begriffs der Nation nicht. Er spricht von "fatalen Auswirkungen ..., die der ethnisch-kulturelle Nationbegriff, als Grundlage für die Bildung von geschlossenen Nationalstaaten genommen, gehabt hat und weiterhin hat" sowie von "Schwierigkeiten bei der Ausländerintegration, die er hervorruft". Ibid., S. 986. Kritischer als das im Text genannte Argument -- und damit weiterhin mehr in Richtung eines ethnischen Identitätskerns -- beurteilt Weinacht die Grundbefindlichkeit Deutschlands auch nach 1945: Paul-Ludwig Weinacht, Nation als Integral moderner Gesellschaft, in: Jürgen Gebhardt/Rainer Schmalz-Bruns (Hrsg.), Demokratie, Verfassung und Nation (Anm. 4), S. 102 ff.
[117] Jürgen Habermas, Eine Art Schadensabwicklung, Frankfurt/M. 1987, S. 135. Der Begriff selbst ist wohl von Sternberger 1982 geprägt worden, vgl. Dolf Sternberger, Verfassungspatriotismus (Schriften Bd. X), Frankfurt/M. 1990, S. 17 ff.
[118] Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Nation (Anm. 108), S. 987 unter Berufung auf Maarten Brands.
[120] Insoweit ist es auch fraglich, ob es um das Konzept des Verfassungspatriotismus, wie wiederum Böckenförde meint, "seit 1990 stiller geworden ist" (ibid.). Um im Bild zu bleiben: Die Tatsache, daß es im nationalistischen Gegröle rechtsextremer Gruppen weniger deutlich vernehmbar ist, entwertet es keineswegs.
[121] Rob Burns/Wilfried van der Will, The Federal Republic From 1968 to 1990: From the Industrial Society to the Cultural Society (Anm. 91), S. 320 f.
[122] Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Nation (Anm. 108), S. 987.
[123] J.H.H. Weiler, Der Staat Òüber allesÓ (Anm. 39), S. 121 ff..
[125] Ibid., S. 120 ff.; vgl. auch dens./Ulrich R. Haltern/Franz C. Mayer, European Democracy and Its Critique, West European Politics Vol. 18 No. 3 (July 1995), S. 4 ff.
[126] Diese Einteilung im Anschluß an Paul-Ludwig Weinacht, Nation als Integral moderner Gesellschaft (Anm. 116). Eine ältere, bekannte Einteilung in Volksnation, Kulturnation, Klassennation und Staatsbürgernation findet sich bei M. Rainer Lepsius, Nation und Nationalismus in Deutschland, in: ders., Interessen, Ideen und Institutionen (Anm. 107). Kritisch zu Typologisierung und funktionalistischer Analyse von Nationen und Nationalismen Michael Jeismann, Alter und neuer Nationalismus, in: ders./Henning Ritter (Hrsg.), Grenzfälle (Anm. 96), S. 9 ff. (11 ff.).
[127] Dieses scheinbar unumgängliche Spannungsverhältnis bringen James March und Johan Olsen auf den folgenden Nenner: ÒAlthough it is built on a credo of individualism and freedom, and must sustain that credo, democracy is also a set of understandings and shared expectations." James G. March/Johan P. Olsen, Democratic Governance (Anm. 81), S. 73.
[129] Hierin liegt zugleich die Nähe als auch der Unterschied zu dem, was Berger und Luckmann die Òreification of social realityÓ nennen. Vgl. Peter L. Berger/Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, 1966.
[130] Verschiedene Motivationslagen sind hierfür denkbar. Neben der von Berger/Luckmann (vgl. vorige Anm.) insinuierten Unbewußtheit -- Menschen kreieren Rituale, Glauben, Mythen oder soziale Rollen, und vergessen dann, daß sie sie kreiert haben, um in einer Welt zu leben, von der sie nicht wissen, daß sie sie geschaffen haben -- ist auch eine "große Verweigerung" (i.S.v. Marcuse) vorstellbar. Verglichen werden kann letzteres etwa mit dem Talmud, im wesentlichen einer Sammlung von Gesetzen und Diskussionen, die ab etwa 120 Jahre nach der Zerstörung des jüdischen Tempels durch die Römer zusammengestellt wurde und sich zu den Regeln jüdischen Lebens so äußert, als ob im Lande Israel noch alles beim Alten sei. Einerseits ermöglichte der Talmud-Diskurs den Juden damit eine Verbindung zu der Möglichkeit einer anderen Realität. Andererseits handelte es sich um eine kühne Leugnung der Realität.
[131] Dies etwa gegen James Boyd White, Law as Rhetoric, Rhetoric as Law: The Arts of Cultural and Communal Life, 52 University of Chicago Law Review 684 (1985). Vgl. hierzu auch Austin Sarat/Thomas R. Kearns (Hrsg.), The Rhetoric of Law, Ann Arbor 1994.
[132] Bernhard Willms, Postmoderne und Politik, Der Staat 28 (1989), 321 ff. (351).
[133] Im uns hier besonders interessierenden politischen System existiert jedoch immerhin die Schranke der Òwehrhaften DemokratieÓ, die dem Pluralismus Grenzen setzt und damit wenigstens zu einem kleinen Teil die Sprache entlastet.
[134] Dieter Grimm, Die politischen Parteien, in: ders., Die Zukunft der Verfassung (Anm. 67), S. 263 ff. (269).
[135] Aber nicht ausschließlich, wie nunmehr BVerfGE 85, 264 (284 f.) - Parteienfinanzierung VI - ausdrücklich klarstellt.
[136] Dieter Grimm, Die politischen Parteien (Anm. 134), S. 264.
[137] Niklas Luhmann, Die Unbeliebtheit der politischen Parteien, in: Siegfried Unseld (Hrsg.), Politik ohne Projekt? (Anm. 46), S. 43 ff. (46) (Hervorhebungen im Original, Anmerkung von mir weggelassen).
[138] Alle bei Kurt Sontheimer, Grundzüge des politischen Systems der neuen Bundesrepublik Deutschland (Anm. 27), S. 207 f.
[139] Bei Karl-Heinz Ladeur, Postmoderne Verfassungstheorie, in: Ulrich K. Preuß (Hrsg.), Zum Begriff der Verfassung - Die Ordnung des Politischen, Frankfurt/M. 1994, S. 304 ff. (314 f.).
[140] Alle bei Dieter Grimm, Die politischen Parteien (Anm. 134), S. 296.
[141] Niklas Luhmann, Die Unbeliebtheit der politischen Parteien (Anm. 137), S. 52.
[142] Dieser Begriff hat sich jedoch seit BVerfGE 4, 27 (30) eingebürgert und war wohl als Abgrenzung gegenüber ÒStaatsorganÓ gedacht. Zur Kritik s. Dieter Grimm, Die politischen Parteien (Anm. 134), S. 278 m.w.Nachw.
[143] Dieter Grimm, ibid., S. 294.
[144] Etwa Ernst-Wolfgang Böckenförde, Der Staat als sittlicher Staat, 1978.
[145] Josef Isensee, Staat und Verfassung, in: ders./Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, Heidelberg 1987, ß 13 (S. 591 ff.), Rdnr. 47 (S. 612).
[146] Ibid. Das Stichwort am Rand heißt ÒKonfliktneutralitätÓ. Auf das Konzept der Konfliktneutralität wird noch ausführlicher einzugehen sein; vgl. unten Anm. 248.
[147] Dieter Grimm, Die politischen Parteien (Anm. 134), S. 265.
[148] Gerhard Leibholz, Verfassungsrechtliche Stellung und innere Ordnung der Parteien, in: Verhandlungen des 38. Deutschen Juristentages (1950), S. C. 10.
[149] Niklas Luhmann, Politische Verfassungen im Kontext des Gesellschaftssystems, Der Staat 12 (1973), S. 1 ff. (5).
[150] Karl-Albrecht Schachtschneider, Res publica res populi. Grundlegung einer allgemeinen Republiktheorie: Ein Beitrag zur Freiheits-, Rechts- und Staatslehre, Berlin 1994. Allerdings zieht Schachtschneider Konsequenzen aus den Grundannahmen, die dem amerikanischen Civic Republicanism fernliegen.Auch Habermas zeigt sich beeinflußt vom Civic Republicanism, der seinem Kampf um die Möglichkeit der Rationalität entgegenkommt: Jürgen Habermas, Faktizität und Geltung (Anm. 107).
[151] Etwa Marc Seidenfeld, A Civic Republican Justification for the Bureaucratic State, 105 Harvard Law Review 1512 (1992). Seidenfeld sieht die Verwaltung als Primärkandidaten zur Institutionalisierung des civic republican Modells an; die dritte Kandidatin, die Judikative, sei overinsulated. Die Parlamentskritik richtet sich primär gegen Cass Sunstein, die Gerichtskritik gegen Frank Michelman.
[152] Vgl. hierzu statt aller Jörg Paul Müller, ëResponsive GovernmentÕ: Verantwortung als Kommunikationsproblem, Zeitschrift für Schweizerisches Recht Bd. 114 (1995), 3 ff. Nur zur Vermeidung von Mißverständnissen sei hinzugefügt, daß sich ÒgovernmentÓ nicht auf die Regierung i.e.S., sondern auf den Staat im allgemeinen bezieht - die unterschiedliche Terminologie entstammt der weniger etatistischen anglo-amerikanischen Tradition.
[153] Vgl. befürwortend insbesondere Gunther Schwerdtfeger, Optimale Methodik der Gesetzgebung als Verfassungspflicht, in: Rolf Stödter/Werner Thieme (Hrsg.), Hamburg - Deutschland - Europa, Festschrift für Hans Peter Ipsen, Tübingen 1977, S. 173 ff.; auch Rüdiger Breuer, Legislative und administrative Prognoseentscheidung, Der Staat 16 (1977), 40 ff. Dagegen etwa Klaus Schlaich, Das Bundesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren, Entscheidungen, 3. Aufl., München 1994, Rdnr. 506; Rainer Wahl, Der Vorrang der Verfassung, Der Staat 20 (1980), 504 ff.; Christoph Gusy, Das Grundgesetz als normative Gesetzgebungslehre, ZRP 1985, 295 ff.
[154] James G. March/Johan P. Olsen, Democratic Governance (Anm. 81), S. 149.
[156] Udo Bullmann, Politische Partizipation - soziale Teilhabe: Die Entfaltung der demokratischen Idee, in: Franz Neumann (Hrsg.), Handbuch Politische Theorien und Ideologien, Bd. 1, Opladen 1995, S. 71 ff.
[157] Die wohl ausführlichste Darstellung heute ist diejenige von Jean L. Cohen/Andrew Amato, Civil Society and Political Theory, Cambridge (Mass.)/London 1992.
[158] Das Ansehen der Bundes- und Landesregierungen ist laut Umfragen des Allensbacher Instituts seit 1980 rapide gesunken. Ebenso hat das Ansehen des Parlaments mit nunmehr nur noch 25 Prozent positiv eingestellter Bürger einen Tiefstand erreicht. Vgl. Bericht der Süddeutschen Zeitung v. 9.12.1995.
[159] Dies gilt aus zwei Gründen eingeschränkt: Zum einen stellt ß 105 BVerfGG eine Durchbrechung der (verfassungs-) richterlichen Unabhängigkeit für Extremfälle dar; zum zweiten ist auch das Bundesverfassungsgericht im Wege der Richterernennung durch Bundestag und Bundesrat personell legitimiert. Die US-amerikanische Situation stellt sich noch anders dadurch dar, daß in vielen Staaten die Richter gewählt werden. Dies hat bereits - in Umkehrung von Bickels beherrschendem Paradigma der counter-majoritarian difficulty" (dazu unten Anm. 183) - einen Autor dazu veranlaßt, von der "majoritarian difficulty" zu sprechen: Steven P. Croley, The Majoritarian Difficulty: Elective Judges and the Rule of Law, 62 The University of Chicago Law Review 689 (1995).
[160] Darüber, daß Gerichte und das Recht allgemein ihren Konsensbedarf extern speisen, dies aber aufgrund des enorm gestiegenen Konsensbedarfs der Rechts-Umwelt nunmehr problematisch geworden ist, berichtet hellsichtig Gunther Teubner, Ist das Recht auf Konsens angewiesen? - Zur sozialen Akzeptanz des modernen Richterrechts, in: Hans-Joachim Giegel (Hrsg.), Kommunikation und Konsens in modernen Gesellschaften, Frankfurt/M. 1992, S. 197 ff.
[161] ÒDas Verfassungsgericht ist Hüter der Verfassung, Wächter aller Rechtswege, Hirte der Rechtsgenossen, die einen Staatsverband bilden. Die Verfassungsgerichtsbarkeit ist Hut des Vorrangs der Verfassung, sie ist die Mitte des Gegenwartsstaates, weil sie die Haupt- und Grundwerte verwirklicht, denen sich die Menschen verschrieben haben: Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Gemeinwohl, Herrschaft des Rechts, Vorherrschaft der Verfassung - und Friede, der bloß als Werk des Rechts gesichert ist. Sie ist, um William E. Gladstone als Zeugen zu führen, 'die wunderbarste Tat, die zu irgendeiner Zeit menschlichen Hirnen entsprungen ist'." René Marcic, Verfassung und Verfassungsgericht, Wien 1963, S. 212.
[162] So berichtet etwa der Spiegel von einer Zahl von 250.000 Briefen innerhalb des Zeitraumes von August 1995 (als das sog. Kruzifix-Urteil veröffentlicht wurde) bis November desselben Jahres. Zum Vergleich: von 1951 bis August 1995 erhielt das Gericht lediglich 160.000 Briefe. Der Spiegel v. 20.11.1995, S. 40.
[163] Indexwerte für Vertrauen in Institutionen ergaben 1983 für das Bundesverfassungsgericht noch eine Spitzenposition (mit einem Indexwert von 74, der die Differenz zwischen Vertrauen und mangelndem vertrauen angibt). Neue Umfragen haben ergeben, daß zwar noch immer eine Mehrheit dem Gericht vertraut (52%), daß aber zwischen Anfang 1994 und Herbst 1995 die Zustimmung in den alten Bundesländern von 51 auf 40% abgerutscht sei. Nur noch ein Drittel der Bevölkerung habe das Gefühl, daß sich ihre Wertordnung mit der des Gerichts deckt. Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts haben Kritik an der Umfrage geäußert. Ob allerdings der weiterhin steigende Geschäftsanfall ein Vertrauensbeweis ist, wie die Präsidentin des Gerichts Limbach meint, darf (bereits logisch) bezweifelt werden. Vgl. für die neueren Daten den Bericht der Süddeutschen Zeitung v. 9.12.1995 sowie FAZ v. 25.10.1995, S. 5; für die Werte von 1983 (und davor) vgl. Christine Landfried, Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber. Wirkungen der Verfassungsrechtsprechung auf parlamentarische Willensbildung und soziale Realität, Baden-Baden 1984, S. 152.
[164] Verwiesen sei nur auf BVerfGE 39, 1 ff. - Schwangerschaftsabbruch I, und BVerfGE 39, 334 ff. - Extremisten im öffentlichen Dienst, innerhalb von drei Monaten (Februar und Mai 1975).
[165] Vgl. Michael J. Perry, Morality, Politics & Law, New York/Oxford 1988; bereits vorher ders., The Constitution, the Courts, and Human Rights: An Inquiry into the Legitimacy of Constitutional Policymaking by the Judiciary, New Haven/London 1982. Vgl. nun aber eine gewisse, offen zugegebene Ernüchterung: ders., The Constitution in the Courts: Law or Politics?, New York/Oxford 1994, z.B. S. 113 f.
[166] Man kommt nicht umhin, wiederum an Ronald Dworkin zu denken, etwa Taking Rights Seriously, Cambridge (Mass.) 1978.
[167] Hierzu zu Recht kritisch das Sondervotum des Richters Grimm in BVerfGE 80, 137, 164 ff. - Reiten im Walde.
[168] Zu den letzteren beiden kritisch Ernst-Wolfgang Böckenförde, Grundrechte als Grundsatznormen. Zur gegenwärtigen Lage der Grundrechtsdogmatik, Der Staat 29 (1990), 1 ff. (abgedruckt in: ders., Staat, Verfassung, Demokratie [Anm. 36], S. 159 ff.).
[169] Luhmann nennt dies das Bemühen des Verfassungsgerichts, Òdie juristische Kontrolle der Entwicklung zum zweckprogrammierten Wohlfahrtsstaat nicht zu verlieren.Ó Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft (Anm. 74), S. 97.
[170] Vgl. bereits Ulrich R. Haltern, Demokratische Verantwortlichkeit und Verfassungsgerichtsbarkeit - Nachbemerkungen zur Diskussion um das Kruzifix-Urteil, Der Staat 35 (1996) (im Druck). Zur Kritik der Depersonalisierung in der amerikanischen Paralleldiskussion vgl. vor allem Pierre Schlag, The Problem of the Subject, 69 Texas Law Review 1627 (1991); ders., Normativity and the Politics of Form, 139 University of Pennsylvania Law Review 801 (1991); ders., 'Le Hors de Texte, C'est moi': The Politics of Form and the Domestication of Deconstruction, 11 Cardozo Law Review 1631 (1990). Vgl. ebenso J.M. Balkin, Understanding Legal Understanding: The Legal Subject and the Problem of Legal Coherence, 103 Yale Law Journal 105 (1993).
[171] Hier unterscheidet Ingwer Ebsen zwischen zwei Richtungen: dem ÒnaivenÓ und dem ÒrestriktivenÓ Ansatz: Ingwer Ebsen, Das Bundesverfassungsgericht als Element gesellschaftlicher Selbstregulierung. Eine pluralistische Theorie der Verfassungsgerichtsbarkeit im demokratischen Verfassungsstaat, Berlin 1985, S. 105 ff.
[172] Vgl. etwa Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Eigenart des Staatsrechts und der Staatsrechtswissenschaft, in: ders., Staat, Verfassung, Demokratie (Anm. 36), S. 11 ff. (19): "[D]ie Arbeit am Staatsrecht [aber darf] nicht selbst von politischen Interessen und Konstellationen überdeterminiert und funktionalisiert werden; sie muß juristisch und als solche integer bleiben..." (Hervorhebung von mir).
[173] Dies macht schon die Systemtheorie klar, indem sie den Code, unter dem das Wissenschaftssystem operiert, als wahr/unwahr identifiziert. Vgl. statt aller Niklas Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt/M. 1990.
[174] James G. March/Johan P. Olsen, Democratic Governance (Anm. 81), u.a. S. 173.
[175] Vgl. die Nachweise oben in Anm. 72.
[176] James G. March/Johan P. Olsen, Democratic Governance (Anm. 81), S. 178.
[177] Vgl. oben - mit Gegenargument - bei Anm. 67.
[178] Dieter Grimm, Verfassungsrechtlicher Konsens und politische Polarisierung in der Bundesrepublik Deutschland, in: ders., Die Zukunft der Verfassung (Anm. 67), S. 298 ff. (303) (Hervorhebung von mir).
[179] Niklas Luhmann, Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen? (Anm. 80), S. 20.
[180] Dieter Grimm, Verfassungsrechtlicher Konsens und politische Polarisierung in der Bundesrepublik Deutschland (Anm. 178), S. 303 f.
[181] Grimms Beitrag erschien ursprünglich in Politische Bildung 17, Stuttgart 1984, S. 35 ff.
[182] Gemeint sind natürlich die Arbeiten etwa von Foucault und Fish.
[183] Der Ausdruck geht zurück auf Alexander M. Bickel, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics, New Haven/London 1962. Die Zeichen, daß die amerikanischen Verfassungsrechtler allmählich genug von diesem in der Tat exzessiv benutzten Paradigma haben, mehren sich. Vgl. etwa Erwin Chemerinsky, The Price of Asking the Wrong Question: An Essay on Constitutional Scholarship and Judicial Review, 62 Texas Law Review 1207 (1984), S. 1207 ("obsession of constitutional law scholarship"); Barry Friedman, Dialogue and Judicial Review, 91 Michigan Law Review 577 (1993), S. 578 ("constitutional scholars have been preoccupied, indeed one might say obsessed, by the perceived necessity of legitimizing judicial review"); Bruce A. Ackerman, The Storrs Lectures: Discovering the Constitution, 93 Yale Law Journal 1013 (1984), S. 1016 ("Hardly a year goes by without some learned professor announcing that he has discovered the final solution to the countermajoritarian difficulty, or, even more darkly, that the countermajoritarian difficulty is insoluable.").
[184] ÒWiederÓ offensichtlich bezogen auf die mitreißenden Debatten während der Weimarer Republik. Vgl. nur die Beiträge von Kelsen, Schmitt und Simons in Peter Häberle (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit, Darmstadt 1976.
[185] Dies auch gegen John Hart Ely, Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review (Anm. 84).
[186] Im alltäglichen Sprachgebrauch ist dieser Ausdruck pejorativ belegt. Spricht dies bereits für eine bestimmte deutsche Prädisposition, so appelliere ich jedoch an den Leser, diese Belegung so weit wie möglich zu vergessen und mit mir im nunmehr neu zu bestimmenden Sinne zu verstehen. Daß sich eine wissenschaftlich informierte Belegung auch in Deutschland häuft, beweist der Beitrag von Helmut Dubiel, Das Gespenst des Populismus, in: ders., Ungewißheit und Politik (Anm. 4), S. 186 ff.
[187] J.M. Balkin, Populism and Progressivism as Constitutional Categories (Anm. 100), auf S. 1946.
[188] Ibid., S. 1947. An dieser Stelle sei noch angemerkt, daß das Verhältnis von Expertise und politischem System keineswegs statisch ist. Die Dynamik ist allerdings eine eher negative. Experten (und Expertise) werden Teil des politischen Systems. Zum einen werden sie dazu benutzt, politische Ansichten mit mehr Legitimation zu versehen; zum anderen wird sowohl den Akteuren (Experten) als auch ihrer Botschaft (Wissen) nunmehr mißtraut, da sie ja nun eine strategisch-politische Rolle spielen. Auch die Experten selbst empfinden sich nun weniger als Teil des Wissenschaftssystems (systemtheoretisch: mit dem Code wahr/ unwahr, also auf der Suche nach der Wahrheit), sondern als Teil des politischen Systems (das nicht unter diesem Code operiert), da sie ja nun "Einfluß haben". Expertise als solche wird hierdurch als Institution unterminiert. Es handelt sich wohl um einen Fall von verlorener Unschuld. Vgl. hierzu auch James G. March/ Johan P. Olsen, Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics, New York 1989, S. 30 ff.
[189] So auch J.M. Balkin, Populism and Progressivism as Constitutional Categories (Anm. 100), S. 1943 f.
[190] Karl Loewenstein, Verfassungslehre, 2. Aufl., Tübingen 1969, S. 461. Vgl. auch etwa Rudolf Smend, Festvortrag zur Feier des zehnjährigen Bestehens des Bundesverfassungsgerichts am 26. Januar 1962, abgedruckt in Peter Häberle (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit (Anm. 184), S. 329 ff., der das Grundgesetz vielsagend mit einer Treibhauspflanze vergleicht: "[N]icht in der freien Luft eines souveränen Staates und Volkes entstanden, sondern beeinflußt, aber auch geschützt durch die Besatzungsmächte, und in seinem Inkrafttreten und Leben abgeschirmt durch das Verbot der radikalen Parteien." Das Grundgesetz sei "[v]on einem nicht an eine demokratische Ordnung gewöhnten und nun seiner Geschichte und der Politik müde gewordenen Volk hingenommen" worden (S. 334).
[191] Ausführlich Ulrich R. Haltern, High Time for a Check-Up: Progressivism, Populism, and Constitutional Review in Germany, Harvard Jean Monnet Working Paper 5/96. Vgl. auch ders., Demokratische Verantwortlichkeit und Verfassungsgerichtsbarkeit (Anm. 170), sub IV.
[192] Rob Burns/Wilfried van der Will, The Federal Republic 1968 to 1990: From the Industrial Society to the Culture Society (Anm. 91), S. 321.
[193] Donald P. Kommers, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, Durham/London 1989, S. 201.
[194] Wolfgang Rudzio, Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, 3. Aufl., Opladen 1991, S. 475 m.w.Nachw. Dieses Urteil wird allgemein geteilt, auch wenn bestimmte Aspekte der deutschen politischen Kultur durchaus kritisch gesehen werden. Vgl. für eine die insbes. US-amerikanische Besatzungszeit miteinbeziehende Analyse Richard L. Merritt, Democracy Imposed - U.S. Occupation Policy and the German Public 1945-1949, New Haven/ London 1995, v.a. S. 387 ff.
[195] J¸rgen Habermas, Die Normalität einer Berliner Republik. Kleine Politische Schriften VIII, Frankfurt/M. 1995; ders., Die zweite Lebensl¸ge der Bundesrepublik: Wir sind wieder ÒnormalÓ geworden, in: Siegfried Unseld (Hrsg.), Politik ohne Projekt? (Anm. 46), S. 283 ff. Eine Mischung aus der Ðberzeugung von der Irreversibilität deutscher demokratischer Kultur einerseits und vorsichtig-nachdenklicher Skepsis andererseits scheint die Mehrheit der Stellungnahmen zu prägen. M.E. repräsentativ etwa Manfred Kuechler, Political Attitudes and Behavior in Germany: The Making of a Democratic Society, in: Michael G. Huelshoff/ Andrei S. Markovits/ Simon Reich (Hrsg.), From Bundesrepublik to Deutschland. German Politics after Unification, Ann Arbor 1993, S. 33 ff. (40): ÒThere is good reason to believe, then, that the Germans have fully embraced democracy, that the process of democratization is irreversible and immune to any challenge. Still, some doubts remain.Ó
[196] Diese Aussage befindet sich zum einen in Übereinstimmung mit der empirischen Erkenntnis, daß das Potential politischer Aktivität der Bürger in den westlichen Demokratien stetig angestiegen ist und weiter ansteigt. Hierfür sind im wesentlichen drei Faktoren verantwortlich: (1) eine bessere politische Bildung und größere politische Informiertheit; (2) das Schrumpfen des weiblichen Politisierungsdefizits, das mit der sich verändernden Rolle der Frau einhergeht; (3) die Verbreitung post-materieller Werte in einer Generation, die in einem Gefühl ökonomischer Sicherheit aufwachsen konnte. Dies führt zu einer Tendenz "from elite-directed to elite-directing politics". Vgl. Ronald Inglehart, Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton 1990, insbes. S. 335 ff. Zum anderen stimmt sie überein auch mit theoretischen Erkenntnissen zu der Möglichkeit und Fähigkeit von Bürgern zu selbstbestimmter und -bestimmender, intelligenter und deliberativer Herrschaft; vgl. hierzu etwa die Beiträge in George E. Marcus/ Russell L. Hanson (Hrsg.), Reconsidering the Democratic Public, University Park (Penns.) 1993.
[197] Peter Häberle, Verfassungsgerichtsbarkeit als politische Kraft, in: ders., Verfassungsgerichtsbarkeit zwischen Politik und Rechtswissenschaft, Königstein/Ts 1980, S. 55 ff.
[199] Beide Zitate ibid., S. 66.
[200] Ibid., S. 67 (Hervorhebung im Original).
[202] Ibid., S. 68 (Hervorhebung im Original).
[205] So aber etwa Korinek im Hinblick auf Häberles Beitrag zum Handbuch des Staatsrechts; Karl Korinek, Rezension von Josef Isensee/ Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland Bde. I und II, AöR 115 (1990), S. 645 ff. (649): "Sodann entwickelt er (methodensynkretisch) seinen eigenen Ansatz, ... was nach Ansicht des Rezensenten die Grenzen staatsrechtlicher Argumentation und die Grenzen intersubjektiver Nachprüfbarkeit überschreitet."
[206] Dies gilt insbesondere für Häberles Projekt der Verfassungslehre als Kulturwissenschaft. Vgl. etwa Peter Häberle, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, Berlin 1982, Einleitung (S. 9), S. 47 ff. m.w.Nachw. Für die kulturwissenschaftliche "Spur" der Weimarer Tradition führt Häberle, aus dem Bereich der Rechtswissenschaft, neben Smend auch Holstein, Hensel, Kohler und Heller an.
[207] Peter Häberle, Verfassungsgerichtsbarkeit als politische Kraft (Anm. 197), S. 68 (Hervorhebung im Original).
[208] Ibid., S. 69 (Hervorhebung im Original).
[209] Ulrich R. Haltern, Demokratische Verantwortlichkeit und Verfassungsgerichtsbarkeit (Anm. 170), sub IV. Zugegeben sei allerdings auch, daß Häberle wiederholt für die Einbeziehung Privater in den staatlichen Erkenntnisprozeß streitet, etwa im Rahmen verfeinerter Hearings, Auskünfte durch Verbände und abgestufte prozeßrechtliche Partizipationsformen. Vgl. etwa Peter Häberle, Grundprobleme der Verfassungsgerichtsbarkeit, in: ders. (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit (Anm. 184), S. 1 ff. (26 f.).
[210] Peter Häberle, Grundprobleme der Verfassungsgerichtsbarkeit (Anm. 209), S. 16 ff.; ders., Verfassungsgerichtsbarkeit als politische Kraft (Anm. 197), S. 71.
[211] Dies ist insbesondere deshalb nicht selbstverständlich, weil Häberles Paradigma seit langer Zeit der Pluralismusbegriff ist, er für eine Òoffene Gesellschaft der VerfassungsinterpretenÓ (JZ 1975, 297 ff.) und ein Verständnis der ÒVerfassung als öffentlicher ProzeßÓ (Berlin 1978) plädiert, und als Vater des status activus processualis gilt -- mithin einer Idee, die eher prozeduralen denn materialen Verfassungstheorien nahezustehen scheint. Jedoch sperrt sich m.E. Häberles Verfassungstheorie einseitiger Zuordnung. In der Tat dürfte sein Projekt im deutschen Verfassungsraum sehr früh Wesentliches zur Debatte um Prozeduralisierung beigetragen haben; zu bedenken aber ist immer das durch stark wertbezogenes grundgesetzliche Denken gekennzeichnete Umfeld. Häberles Position ist insofern besonders interessant, da sie prozedurale Gerechtigkeitsüberlegungen mit materialen Konzepten zur deliberativen Demokratie verknüpft.
[212] Peter Häberle, Verfassungsgerichtsbarkeit als politische Kraft (Anm. 197), S. 71 f.
[213] Ibid., S. 74 ff. Hierzu sei einerseits bemerkt, daß man Häberle nicht den Vorwurf machen kann, er sähe Fortschritt auf die Aktivitäten des Bundesverfassungsgerichts beschränkt; er sieht durchaus, daß die Urteile des Gerichts auch durchaus Fortschritt verhindern können, bzw. das Fortschritt ganz ohne gerichtliche Beteiligung zustande kommt (ibid., S. 76). Andererseits ist wiederum darauf hinzuweisen, daß der Fortschrittsbegriff, den Häberle verwendet und der durch das Koordinatensystem Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit, Gerechtigkeit und Gemeinwohl gekennzeichnet ist, sich der nunmehr bekannten Wertekritik aussetzt.
[214] Der Punkt ist nicht, daß mir ein gehobenes Verständnis von Kultur an sich suspekt ist -- ganz im Gegenteil fühle ich mich Häberle hier nahe. Jedoch geht es um den geringen Respekt, mit dem der Progressivismus die Populärkultur behandelt und in selbstverständlicher Geste verwirft. (Vgl. zu diesem Thema bereits die Nachweise oben in Anmerkung 97.) Es ist genau dieser Anspruch, den etwa Jack Balkin kritisch aufgreift (J.M. Balkin, Populism and Progressivism as Constitutional Categories [Anm. 100]). Ebenso ist es genau an dieser Stelle, an der die postmoderne Forderung nach Resubjektivierung etwa des rechtswissenschaftlichen Schrifttums ihre Berechtigung findet. Anders ausgedrückt: Es mag hilfreich sein, sich -- als Richter, Professor, Jurist im allgemeinen -- der privilegierten Stellung (etwa im Hinblick auf Bildung) bewußt zu werden, die man innehat. Häberle bekennt sich zwar an anderer Stelle mehr oder weniger deutlich zu einem offenen Kulturverständnis: "In Abkehr von einem (nur) 'bildungsbürgerhaften' Kulturverständnis soll die Grundlage der folgenden dogmatischen Überlegungen ein offenes Kulturkonzept sein: 'Kultur für alle' (H. Hoffmann) und 'Kultur von allen'. Dies bedingt eine Ausweitung und Dynamisierung des Kulturbegriffs. Der weite, vielfältige, offene Kulturbegriff umschließt die bürgerliche Traditions- und Bildungskultur ebenso wie 'Populär'- und Breitenkultur, wie Alternativ-, Sub- und Gegenkulturen." (Peter Häberle, Vom Kulturstaat zum Kulturverfassungsrecht, in: ders. [Hrsg.], Kulturstaatlichkeit und Kulturverfassungsrecht [Anm. 87], S. 1 ff. [31 f.] - Anmerkungen von mir weggelassen.) Wohlgemerkt aber unterscheidet Häberle zwischen einer "Öffnung" des Kulturbegriffes und dessen "totaler Entgrenzung" (ibid. in Fußnote 99): "Gibt man sich ganz einem 'entlaufenen' Kunstbegriff hin, so droht in der Tat die Gefahr der Auflösung der Kulturwissenschaft als Disziplin." (Anmerkung von mir weggelassen.) Wir wissen hiermit nicht viel anzufangen. Gehören auch Madonna, MTV, die Simpsons und das Glücksrad mit in einen "offenen Kulturbegriff" oder würden sie "totale Entgrenzung" bedeuten? Die Tatsache, daß Häberle wiederholt Joseph Beuys für seinen erweiterten Kulturbegriff zitiert (ibid.; ebenso ders., Verfassungslehre als Kulturwissenschaft [Anm. 206], S. 27), scheint zumindest eine Richtung anzudeuten.
[215] Peter Häberle, Verfassungsgerichtsbarkeit als politische Kraft (Anm. 197), S. 79. Ein gleichgelagerter Gedanke findet sich im übrigen auch bei dem mitunter recht obrigkeitsstaatlich ausgerichteten René Marcic, Verfassung und Verfassungsgericht (Anm. 161), S. 212, der die "umfassende und tiefe pädagogische, edukatorische und didaktische Wirkung, die das Verfassungsgericht zu tun vermag," hervorhebt. Die Auffassung, daß Verfassungsgerichtsbarkeit die Aufgabe notwendiger politischer Erziehungsarbeit für das deutsche Volk zu erfüllen habe, war in den Anfängen der Bundesrepublik weit verbreitet; vgl. etwa auch Rudolf Smend, Festvortrag (Anm. 190), S. 337: "Die Bundesverfassungsgerichtsbarkeit ist ... eine ... Tatsache, aus der die Bürger der Bundesrepublik lernen können und lernen, fruchtbar in ihrer politischen Erziehungswirkung und in dem damit eng verbundenen Zusammenhang der Legitimierung des Grundgesetzes. Es sind geschichtliche Vorgänge verschiedenster Art, durch die ein Volk sich seine Verfassung aneignet, sie legitim macht. ... Es wird Sache des künftigen Historikers sein, diesen Anteil des Bundesverfassungsgerichts am 'Gründungs- und Festigungswerk' unserer Demokratie endgültig zu bestätigen."
[216] Ulrich R. Haltern, Demokratische Verantwortlichkeit und Verfassungsgerichtsbarkeit (Anm. 170); ausführlicher ders., High Time for a Check-Up (Anm. 191).
[217] Vgl. supra im Text zu Fußnoten 192-194.
[218] Etwa Peter Häberle, Erziehungsziele und Orientierungswerte im Verfassungsstaat (Anm. 214), S. 73.
[219] Robert Cover, Violence and the Word, 95 Yale Law Journal 1601 (1986), S. 1601; wiederabgedruckt in Martha Minow/ Michael Ryan/ Austin Sarat (Hrsg.), Narrative, Violence, and the Law: The Essays of Robert Cover, Ann Arbor 1993, S. 203 ff. (203).
[220] Ausführlich hierzu auch die Beiträge in Austin Sarat/Thomas R. Kearns (Hrsg.), The Rhetoric of Law (Anm. 131); dies. (Hrsg.), LawÕs Violence, Ann Arbor 1992; Peter Brooks/Paul Gewirtz (Hrsg.), LawÕs Stories: Narrative and Rhetoric in the Law, New Haven/London 1996.
[221] Nur zum Beispiel stelle man sich vor: den Soldaten, der sich weigert, seinen Dienst Òout of areaÓ zu verrichten; die Frau, die ihre Schwangerschaft aus anderen als den strafgesetzlich zugelassenen Gründen abbrechen will.
[222] Ingwer Ebsen, Das Bundesverfassungsgericht als Element gesellschaftlicher Selbstregulierung (Anm. 171). Ebsen skizziert den pluralistischen Ansatz ebd., S. 192 ff., und erläutert sein eigenes Konzept auf S. 218 ff.
[223] Vgl. etwa ibid., S. 215, wo Ebsen Häberle eine Òmit breitem Pinsel arbeitende DarstellungstechnikÓ bescheinigt.
[224] Ibid., S. 229; im einzelnen S. 320 ff.
[225] Alle drei Zitate ibid., S. 322.
[229] Ò[Die Verfassung hat auch die Funktion,] quasi vertragsartig die Inhalte festzulegen, die zwar interessenmäßig kontrovers sind, aber dennoch dem normalen politischen Prozeß der Mehrheitsentscheidung entzogen sein sollen.Ó Ibid., S. 346 (meine Hervorhebung). Möglicherweise geht Ebsen in diesem Punkt noch über Häberle hinaus. Während letzterer, wie gezeigt, den Gesellschaftsvertrag als Gedankenmodell versteht, beruft sich Ebsen ausdrücklich auf Smend (ibid., S. 349 bei Fußnote 146), der gerade darauf besteht, daß der "Staatsvertrag", der "Sozialkontrakt in Bewegung", eine soziologische oder phänomenologische Wirklichkeit mit realem Gehalt ist: Rudolf Smend, Verfassung und Verfassungsrecht (Anm. 5), S. 180 ff. Zu beachten ist aber, daß Ebsen keinesfalls als in Smendscher Tradition schreibend betrachtet werden kann. Ebsens handlungstheoretischer Ansatz verträgt sich nicht mit Smends ganzheitlicher Lehre: "So ist es für Smend nicht denkbar, den Staat als System spezifischer Handlungen von Individuen in besonderen Rollen zu begreifen." (Niklas Luhmann, Grundrechte als Institution - Ein Beitrag zur politischen Soziologie, Berlin 1965, S. 46).
[233] Ibid., etwa S. 221 ff., 348.
[234] ÒDie Gleichzeitigkeit von sozialem Konflikt und einheitsstiftendem Konsens erlaubt es, die Gesellschaft einerseits als selbstorganisierendes, an konsensgetragenen Systemzielen ausgerichtetes System zu sehen und andererseits - innerhalb eines hierdurch gegebenen Rahmens - die Prozeßhaftigkeit der sozialen Entwicklung anzuerkennen." Ibid., S. 221. Ebsen anerkennt ausdrücklich die Nähe zum Sektor-Modell Fraenkels: "Diese Gleichzeitigkeit zweier einander ausschließender Modelle führt nur dann nicht in Widersprüche, wenn man in der Lage ist, den beiden Modellen unterschiedliche Wirklichkeitsbereiche zuzuordnen und diese Bereiche in ihrer Beziehung zueinander zu erklären. Dies geschieht in der pluralistischen Gesellschaftstheorie durch die Unterscheidung zwischen 'kontroversem' und 'nicht-kontroversem Sektor' bzw. Konfliktbereich und Konsensbereich." Ibid., S. 220 (mit Verweisen auf Fraenkel, Kremendahl und Göldner).
[235] Ibid., S. 220 in Fußnote 14. Müllers Aussage in Jörg Paul Müller, Grundrechtliche Anforderungen an Entscheidungsstrukturen, in: Festschrift für Kurt Eichberger, Basel u. Frankfurt/M. 1982, S. 169 ff. (169 f.).
[236] Vgl. nur einerseits John Hart Ely, Democracy and Distrust (Anm. 185), andererseits Laurence H. Tribe, The Puzzling Persistence of Process-Based Constitutional Theories, 89 Yale Law Journal 1063 (1980). Einer der verbleibenden Bannerträger der prozessualen Theorie ist Michael J. Klarman, The Puzzling Resistance to Political Process Theory, 77 Virginia Law Review 747 (1991).
[237] Ingwer Ebsen, a.a.O., S. 347.
[238] So aber ibid., etwa S. 347: Ò[D]a die befriedende ëErledigungÕ eines Verfassungsstreits durch Annahme der Entscheidung durch die unterlegene Partei nicht dadurch erreicht werden kann, daß die Entscheidung auf zweifelsfrei ëgeltendesÕ Verfassungsrecht gegründet werden kann, muß die Annahme durch den Verfassungsprozeß selbst bewirkt werden."
[240] Vgl. zur Òfortdauernden FehdeÓ in der amerikanischen Öffentlichkeit, Politik und Rechtswissenschaft etwa Winfried Brugger, Persönlichkeitsentfaltung als Grundwert der amerikanischen Verfassung (Anm. 103), v.a. S. 16 ff.
[242] Klaus von Beyme, Theorie der Politik im 20. Jahrhundert (Anm. 29), S. 200.
[243] Helmut Willke, Ironie des Staates. Grundlinien einer Staatstheorie polyzentrischer Gesellschaft, Frankfurt/M. 1992, S. 359 (Hervorhebung von mir weggelassen).
[244] Helmut Dubiel, Metamorphosen der Zivilgesellschaft II (Anm. 4), S. 114 f. Dubiel schließt an Ulrich Rödel/Günter Frankenberg/Helmut Dubiel, Die demokratische Frage, Frankfurt/M. 1989, etwa S. 117 ff. an.
[245] Zitierenswert ist in diesem Zusammenhang Luhmanns ironische Stellungnahme zum Konsens-Problem: ÒDie Unmöglichkeit eines Konvergierens von Mentalzuständen einzelner gilt auch für den Alltag, auch für die Lebenswelt, wenn man einmal von kurzfristigen Interaktionen unter Anwesenden absieht. Die Lebenswelt ist ja kein dauerndes Riesen-Rock-Festival, das alle fasziniert und nur durch die Systeme, wie durch die Polizei, gestört wird. Konsens ist und bleibt eine Konstruktion eines Beobachters, und das gilt um so offensichtlicher, je mehr dieser Konsens im Namen der Vernunft und im Namen der Moral reklamiert wird. Aus den zweiten Blick sieht man dann natürlich, daß das politische System selbst solche Vorstellungen erzeugt, um in der politischen Kommunikation das reale Individuum außer Acht lassen zu können und statt dessen im rekursiv-geschlossenen eigenen Operationszusammenhang Konsens zu fordern, unter Bedingungen zu stellen oder sein Fehlen beklagen zu können. Daß man sich dauernd mit etwas befaßt, das es weder gibt noch geben kann, ist ein Beweis mehr für meine These, daß die Politik nicht weiß, und nicht wissen kann, mit welcher Gesellschaft, mit welchen Menschen, mit welcher Außenwelt sie es zu tun hat." Niklas Luhmann, Enttäuschungen und Hoffnungen - Zur Zukunft der Demokratie, in: ders., Soziologische Aufklärung 4: Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft, Opladen 1987, S. 133 ff. (139).
[246] Josef Isensee, Staat und Verfassung (Anm. 145), Rdnr. 55 (S. 614).
[248] Ibid., Rdnr. 47. Für das amerikanische Verfassungsrecht sei auf den berühmten Aufsatz Wechslers hingewiesen, der mit einer im Zeichen der Neutralität geführten Attacke auf so bekannte civil rights-Entscheidungen wie Brown v. Board of Education die akademische Fachwelt überraschte: Herbert Wechsler, Towards Neutral Principles of Constitutional Law, 73 Harvard Law Review 1 (1959). Aus der unüberschaubaren Kritik nur etwa Addison Muellerson/Murray L. Schwartz, The Principle of Neutral Principles, 7 U.C.L.A. Law Review 571 (1960); Pierre Schlag, 'Le Hors de Texte C'est Moi': The Politics of Form and the Domestication of Deconstruction (Anm. 170).
[249] Erwähnt seien lediglich die Arbeiten Karl-Otto Apels, etwa Diskurs und Verantwortung - Das Problem des Übergangs zur postkonventionellen Moral, Frankfurt/M. 1988, oder Fallibilismus, Konsenstheorie der Wahrheit und Letztbegründung, in: W.R. Köhler et al. (Hrsg.), Philosophie und Begründung, Frankfurt/M. 1987; daneben die bekannten Arbeiten von Jürgen Habermas und John Rawls sowie die kritischen Auseinandersetzungen hiermit. Hervorgehoben sei als solche Nicholas Rescher, Pluralism - Against the Demand for Consensus, Oxford 1993.
[250] Zum begrenzten Wert von Meta-Diskursen für denjenigen, der das Recht unmittelbar praktiziert, vgl. Stanley Fish, The Law Wishes to have a Formal Existence, in: ders., There's No Such Thing As Free Speech, and It's a Good Thing Too, New York/Oxford 1994, S. 141 ff.