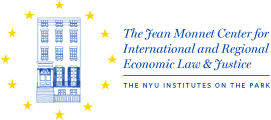
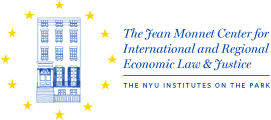 |
Ulrich R. Haltern , LL.M. (Yale)[1]
©Copyright: Ulrich R. Halterng, 1996.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit des Anbringens von Kreuzen und Kruzifixen in staatlichen Pflichtschulen[2] hat die ohnehin schwelende Diskussion um die legitime Stellung des Verfassungsgerichts im Staatsgefüge in bisher nicht erreichter Schärfe angefacht. Der Verfassungsdiskurs hat sich beispiellos ausgedehnt, auf Politiker, Vertreter von Interessengruppen, Kirchen, Elternvereine, Bürger. Zahlreiche Staatsrechtler haben bereits Stellung bezogen, wobei es weder an kritischen noch verteidigenden Anmerkungen fehlt. Der vorliegende Beitrag will dieser Flut von Stellungnahmen nicht noch eine weitere hinzufügen. Vielmehr geht es hier darum, einen größeren Rahmen für die Diskussion abzustecken. Nicht das Urteil selbst steht im Mittelpunkt, sondern sein Umfeld: die Institution der Verfassungsgerichtsbarkeit, das demokratische System, der Grundsatz der demokratischen Verantwortlichkeit. Dieser Beitrag verfolgt das Ziel, nach einem kritischen Blick auf die Diskussion der Verfassungsgerichtsbarkeit eine neue Perspektive auf das Prinzip der demokratische Verantwortlichkeit zu eröffnen und somit die Stellung des Bundesverfassungsgerichts im Verfassungsgefüge gewissermaßen von der anderen Seite her anzugehen. Der Autor hofft, hiermit ein Gegengewicht zum modischen Verfassungsgerichts-trashing setzen zu können, ohne gleichzeitig in einen unangemessenen Verfassungspositivismus zu verfallen.
Nicht erst seit der Senatsentscheidung im Kruzifix-Fall steht das Bundesverfassungsgericht unter Beschuß. Fälle wie die beiden Entscheidungen zum Schwangerschaftsabbruch, zum Einsatz der Bundeswehr ãout of area", zur Meinungsfreiheit (ãSoldaten sind Mörder") oder, zuvor, die Mitbestimmungsentscheidung oder die Entscheidung zu Extremisten im öffentlichen Dienst haben nicht nur inhaltliche Substanzkritik hervorgerufen, sondern ebenso Zweifel an der legitimen Reichweite der Verfassungsgerichtsbarkeit im demokratischen System provoziert. Bewirkt allerdings haben diese Äußerungen wenig. Dies liegt nicht unbedingt an einer Verkrustung des politisch-institutionellen Regierungssystems oder einem eingefahrenen Rechtsprechungsrhythmus in Karlsruhe. Vielmehr muß sich die Kritik den Spiegel vorhalten und fragen lassen, ob sie denn ein ausreichendes Maß an Kohärenz und Überzeugungskraft entfalten konnte, um zu erwartende Widerstände und Automatismen zu überwinden. Hier ist Skepsis angebracht. Man kann zwei Argumentationslinien unterscheiden, die beide unter erheblichen Mängeln leiden.
Zum einen beschränkt sich die Kritik am Bundesverfassungsgericht häufig auf rechts-"technische" Details und verpaßt eine grundsätzliche Analyse der Institution der Verfassungsgerichtsbarkeit. Dies mag man darauf zurückführen, daß das Bundesverfassungsgericht -- anders als etwa der Supreme Court der Vereinigten Staaten von Amerika, der sich seine richterliche Prüfungs- und Verwerfungskompetenz selbst zusprechen mußte[3] -- eine feste verfassungsmäþige Grundlage in der Verfassung hat und somit die Notwendigkeit einer theoretischen Begründung der Verfassungsgerichtsbarkeit fortfällt. Der tiefere Grund jedoch liegt in einem fest verwurzelten Mißtrauen gegenüber der Politik, das dazu führt, den verfassungsrechtlichen Diskurs als reinen Rechtsdiskurs führen zu wollen. Das Rechtssystem wird als Wissenschaft begriffen, die in einem Rahmen strikt rationaler, intersubjektiv vermittel- und nachprüfbarer, insofern objektiver Kriterien und Standards operiert und die gegenüber dem politischen Prozeß ihre Integrität zu bewahren hat.[4] Verfassungsrechtler, die etwa den frühen amerikanischen legal realism oder die daraus entstandene critical legal studies-Bewegung kennen, wissen um die Brüchigkeit dieser Argumentation. Man muß sich keineswegs mit dem Schlachtruf ãlaw is politics" identifizieren um anzuerkennen, daß ein solcher Isolationismus schwerlich kohärent durchzuhalten ist. Die Diskussion des Kruzifix-Urteils hat den Rechtsdiskurs entmystifiziert und entprofessionalisiert und zugleich einen letzten Nachweis erbracht (soweit es eines solchen überhaupt noch bedurfte), daß das Bundesverfassungsgericht sich nicht mehr durch Experten-Semantik von politischer (demokratischer) Verantwortlichkeit immunisieren kann. Und doch ist die Auffassung vom ãunschuldigen Recht", das wiederum Teil des ãMythos der unbefleckten Wahrheit" ist (auf den noch ausführlich zurückzukommen ist), das wohl führende Paradigma des (konventionellen) deutschen Rechtsdiskurses. Folgt man ihm, so ergibt sich folgendes klassisches Bild: Verfassungsgerichtsbarkeit ist das Schwert, das dem Recht gegenüber der Politik verliehen ist. Das Recht enthält objektive rationale Vorgaben gegenüber der Politik; es kann im Grundsatz nichts Verwerfliches daran entdeckt werden, daß die Verfassung (mit all den Werten, die durch sie verkörpert werden: Rechtmäßigkeit, Menschlichkeit, Konsens, Individualität, Toleranz, Sicherheit, Liberalität, menschenrechtlicher Schutz, Vorhersagbarkeit, insgesamt: Tugend) als Rahmen für und Rammbock gegen das rauhe Tagesgeschäft der Politik wirkt. Was der amerikanische Verfassungsrechtler seit Alexander Bickels bahnbrechender Abhandlung die ãcounter-majoritarian difficulty" nennt[5], nämlich das Verwerfen einer durch direkt gewählte Vertreter des Volkes gefällten Entscheidung, taucht in dieser Version des Wahrheitsmythos kaum auf. Wenn sie wahrgenommen wird, so lediglich dergestalt, daþ eine zu aufdringliche Verfassungsgerichtsbarkeit sowohl das politische System als auch die Öffentlichkeit derart in Rage versetzen könnte, daþ hieraus positiv-verfassungsrechtliche Konsequenzen zu befürchten wären, etwa das Beschneiden der Kompetenzen des Bundesverfassungsgerichts in Art. 93 GG (i.V.m. dem BVerfGG). Die Therapie hierfür ist richterliche Zurückhaltung -- ein Konzept, das, mit Alfred Rinken, dem Gericht eine ãopportunistisch-dezisionistische richterliche Kompetenz-Kompetenz" zuerkennt.[6]
Die zweite Argumentationslinie bricht mit einer strengen Trennung zwischen Recht und Politik. Sie anerkennt etwa, daß politische Erwägungen in verfassungsgerichtlichen Entscheidungen eine erhebliche Rolle spielen, oder daß das politische System Entscheidungen nach Karlsruhe abschiebt.[7] Dies ist insofern ein Fortschritt, als damit das Gericht als politischer Akteur in den Blick genommen werden kann und die Frage der demokratischen Legitimation (und damit auch die counter-majoritarian difficulty) virulent wird. Jedoch leidet auch diese Argumentation an Schwachpunkten, die wiederum ihre Überzeugungskraft in erheblichem Maße unterminieren. Ihr Hauptproblem besteht in ihrer Selektivität. Sie wird insbesondere von denjenigen geübt, deren Auffassung im verfassungsgerichtlichen Prozeß unterlegen war und die nunmehr in Rückzugsgefechten den locus decisionis angreifen. Warum auch sollte eine obsiegende Partei die Legitimität des Verfassungsgerichts anzweifeln? Wenn wir anerkennen, daß der Gang zum Verfassungsgericht bei manchen Verfahren einen Weg zur Durchsetzung politischer Interessen darstellt, dann ist zugleich zu konstatieren, daß diese Art der Durchsetzung mittels Instrumentalisierung des Rechtssystems wohl die durchschlagkräftigste, effizienteste und erdrutschartigste ist. Zum einen wird das Mehrheitsprinzip außer Kraft gesetzt, so daß auch (und gerade) die politische Opposition zum Zuge kommt. Zum zweiten verleiht der Stempel der Verfassungsmäßigkeit einer politischen Zielsetzung ebenso das Siegel besonderer Moralität. Die Ansicht des politischen Gegners wird als ãverfassungswidrig" gebrandmarkt, also als den Werten kraß zuwiderlaufend, die das Grundgesetz kennzeichnen (wie bereits erwähnt: Toleranz, Minderheitenschutz, Legalität, Tugendhaftigkeit etc.), während die eigene Auffassung mit diesen Werten konform geht und somit moralisch überlegen ist. Aus einem politischen Sieg wird nicht nur ein rechtlicher, sondern zugleich ein moralischer. Zum dritten verbinden sich nunmehr mit der politischen Entscheidung die Konsequenzen einer verfassungsgerichtlichen Rechtsentscheidung: Recht ist weit weniger flexibler als Politik, die Entscheidung kann nicht mehr im politischen Tagesgeschäft abgeändert werden, sondern (häufig) nur noch durch qualifizierte Mehrheiten im verfassungsändernden Verfahren. Wer würde unter diesen Umständen die Quelle dieses Privilegs, das Bundesverfassungsgericht, untergraben? Hieraus ergibt sich als Konsequenz, daß die Kritik am Verfassungsgericht materiell informiert ist. Nur die Verliererpartei (und alle, die ihre Ansichten teilen) kritisiert -- und damit leidet die Kritik von vornherein an dem Mangel, daß sie durch den in Frage stehenden Streitgegenstand politisch beeinflußt ist. Sie erlangt keine grundlegende Akzeptanz, sondern beschränkt sich auf die Anhängerschaft bestimmter politischer Überzeugungen. So zeigt sich etwa, daß nach den Entscheidungen zum Schwangerschaftsabbruch das nicht-konservative Lager primär bundesverfassungsgerichts-kritisch eingestellt war, während umgekehrt eher Konservative an der Institution der Verfassungsgerichtsbarkeit wenig auszusetzen hatten. Bereits durch diese politische Informiertheit wird die institutionelle Kritik kompromittiert. Aber es kommt noch weitaus schlimmer: Mehrheiten wechseln. Während heute das eher konservative Lager jubilierend das Bundesverfassungsgericht stützt (Schwangerschaftsabbruch), ist es morgen die politische Linke, die an der counter-majoritarian difficulty nichts auszusetzen findet (Kruzifix). Es bedarf kaum näherer Ausführungen, daß hierdurch die Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit politisch motivierter Kritik an der Verfassungsgerichtsbarkeit stark leidet.
Die Diskussion um bundesverfassungsgerichtliche Legitimität verläuft zumeist so, daß die Kritiker (und substantiell-politisch Unterlegenen) die zweite Argumentationslinie verfolgen, woraufhin sich die andere Seite (zumeist die politisch Obsiegenden) auf Verfassungspositivismus sowie den Mythos unbefleckter Wahrheit zurückzieht. Als Diskussionsmuster kann dies auf Dauer nicht befriedigen. Der Öffentlichkeitswirksamkeit der Kruzifix-Diskussion ist als Positivum jedenfalls abzugewinnen, daß sie die Notwendigkeit einer vertieften theoretischen Durchdringung der Institution der Verfassungsgerichtsbarkeit in aller Schärfe und Dringlichkeit verdeutlicht. Die deutsche Staatsrechtslehre muß hierbei nicht bei Null beginnen. Trotz der vielen Punkte, die einen Vergleich zwischen Bundesverfassungsgericht und Supreme Court ins Zwielicht geraten lassen, hat die amerikanische Verfassungslehre in abstracto Modelle entworfen, die jeder Diskussion von verfassungsgerichtlicher Legitimität von Nutzen sind. Obwohl insbesondere Winfried Brugger[8] bereits verdienstvoll auf die amerikanische Debatte hingewiesen hat, sollen hier in neuer Ordnung einige wichtige Modelle vorgestellt werden. Dabei wird sich zeigen, daß auch die US-amerikanische judicial review-Diskussion einem Schema folgt, das nicht immer ganz befriedigen kann. Der Antagonismus zwischen Mehrheitsprinzip und Konstitutionalismus wird zwar scharf erkannt und immer neu referiert, wobei die Problematik der defizitären demokratischen Legitimation der Verfassungsgerichtsbarkeit gegenüber der Legislative in den Mittelpunkt rückt. Dem Ursprung dieses Legitimationsdefizites aber -- das als solches zunächst kaum zu leugnen ist, da das Parlament nun einmal direkt vom Volk gewählt wird[9] -- wird kaum noch aufmerksamen Sinnes nachgegangen. Insbesondere verlieren die darzustellenden Modelle die Abstufungen und vor allem die Funktion demokratischer Verantwortlichkeit aus den Augen. Dies hat zur Folge, daþ der Versuch, legislatives Mehrheitsprinzip und Verfassungsgerichtsbarkeit konzeptionell miteinander zu vereinbaren, regelmäþig mit einer Beschneidung letzterer endet. Die im folgenden anzuführenden Lösungsangebote haben bei allem Gedankenreichtum und aller Innovativität gemeinsam, daß sie lediglich Abstriche auf der einen Seite machen; das goldene Kalb der demokratischen Verantwortlichkeit bleibt grundsätzlich unangetastet.
Zunächst kann man zwischen dem anti-demokratischen und dem demokratischen Modell unterscheiden. Das erstere behauptet eine grundsätzliche Unvereinbarkeit von Verfassungsgerichtsbarkeit und Demokratie, während das letztere um eine Versöhnung beider bemüht ist. Innerhalb beider Modelle lassen sich wiederum eine Reihe weiterer Argumentationen unterscheiden. Dazu der folgende Überblick:
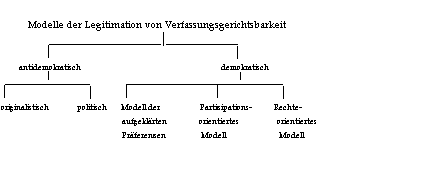
Die originalistische Variante der Unvereinbarkeitsbehauptung von Verfassungsgerichtsbarkeit und Demokratie wird insbesondere von Robert Bork vertreten.[10] Danach handeln Richter dann undemokratisch, wenn sie von der Oberfläche des Verfassungstextes abweichen. Sie sollen stattdessen den Willen der Legislative respektieren, es sei denn, diese handelt ausdrücklich gegen den klaren Buchstaben des Verfassungsgesetzes. Der Ausgangspunkt dieser Auffassung besteht darin, daþ es keine privilegierten Antworten auf Fragen der politischen Moralität über das hinaus gibt, was ausdrücklich in der Verfassung niedergelegt oder was durch den Willen der politischen Mehrheit gewollt ist. Herrschaft ist nur insoweit gerechtfertigt, als sie den mehrheitlichen Willen reflektiert. Da Richter nicht direkt gegenüber der Mehrheit verantwortlich sind, dürfen sie deren Willen nicht zuwiderhandeln (es sei denn die Verfassung sieht dies ausdrücklich vor); ebenso sollten sie sich den anderen Gewalten unterwerfen, soweit diese nicht offensichtlich falsch liegen.
Die Argumentation, die ich die ãpolitische" genannt habe, teilt mit den Originalisten die Annahme, daß die counter-majoritarian difficulty unlösbar sei. Ihre Befürworter jedoch argumentieren nicht wider, sondern für richterliche Macht. Meist Teil der critical legal studies-Bewegung und genau am anderen Ende des politischen Spektrums angesiedelt, sehen sie Verfassungsgerichtsbarkeit als ãalles oder nichts"-Problem: ãEntweder man erlaubt Richtern, alles zu tun was sie wollen, oder man erlaubt der Mehrheit, alles zu tun was sie will."[11] Nach dieser Auffassung sind richterliche Entscheidungen unvermeidbar politische Entscheidungen. Es handelt sich um eine politische Theorie des Verfassungsrechts: ãRichter sollten sich nicht selbst betrügen, indem sie denken, daß das, was sie tun, eine Bedeutung hat, die anders oder weiter ist als diejenigen Handlungen, die andere politische Akteure vollziehen."[12]
Andere Modelle haben versucht, Demokratie und Verfassungsgerichtsbarkeit miteinander zu versöhnen, zumeist, indem sie letztere in den Dienst ersterer stellen. Hier wiederum können drei verschiedene Ansätze voneinander unterschieden werden: das Modell der aufgeklärten Präferenzen, das Partizipations-orientierte Modell, und das Rechte-orientierte Modell.
Das Modell der aufgeklärten Präferenzen führt so unterschiedliche Autoren wie Alexander Bickel und Bruce Ackerman zusammen. Beide gehen davon aus, daß demokratische Legitimität letztlich im Mehrheitswillen verwurzelt ist und daß Verfassungsgerichtsbarkeit diesen Mehrheitswillen mehr oder weniger repräsentiert. Nach Bickel vermittelt die Verfassungsgerichtsbarkeit zwischen den kurzfristigen Präferenzen der Mehrheit (repräsentiert durch Exekutive und Legislative) und denjenigen Prinzipien, die die Mehrheit auf längere Sicht befürworten würde. Die Gerichte seien diejenige Institution, die diese Prinzipien am besten hüten könne.[13] Dagegen unterscheidet Ackerman zwischen "normal politicsî, welche im täglichen politischen Prozeþ entsteht, und "higher politicsî, die nur in seltenen konstitutionellen Momenten zustandekommt. In Zeiten von -- gegenüber den Tugenden der "higher politics" demokratisch inferiorer -- normaler Politik bewahrt das Verfassungsgericht die Identität, die die Mehrheit für sich selbst in Zeiten von "higher politics" erschaffen hat, also gewissermaßen das bessere Selbst der Mehrheit.[14] Es erhellt, daþ Ackerman vergangenheitsorientiert, Bickel dagegen zukunftsorientiert ist. Trotz dieses wichtigen Unterschiedes vereinbaren beide Demokratie und Verfassungsgerichtsbarkeit auf eine ähnliche Art und Weise: Regierungsgewalt ist dann legitim, wenn sie den Mehrheitswillen umsetzt. Dieser aber manifestiert sich auf verschiedenen Ebenen, und das Verfassungsgericht ist dazu aufgerufen, den sich durch größere Autorität auszeichnenden Ausdruck des Mehrheitswillens gegen solchen von weniger Autorität zu verteidigen. Dieses Modell der verfassungsgerichtlichen Legitimation verdeutlicht wie kein anderes das Bestreben, demokratische Verantwortlichkeit im Zentrum des Gemeinwesens unangetastet zu lassen. Selbst die eklatante Durchbrechung von direkter Verantwortlichkeit wird als Repräsentation (und damit letztlich Verantwortlichkeit) begriffen.
Das Partizipations- (oder auch Repräsentations-) orientierte Modell wird insbesondere von John Hart Ely vertreten. Danach ist es Aufgabe der Verfassungsgerichtsbarkeit, die Rolle eines "Wachhundes der Demokratie" einzunehmen und sicherzustellen, daß niemand von der demokratischen Entscheidungsfindung ausgeschlossen ist.[15] Elys (prozeþorientierte) Auffassung kann man etwa wie folgt zusammenfassen: Die Ausübung von Regierungsgewalt ist legitim, soweit sie den Mehrheitswillen fördert (in den Grenzen ausdrücklicher verfassungsrechtlicher Beschränkungen). Während die Legislative und die Exekutive ausreichend demokratisch legitimiert sind, um politische Gewalt auszuüben, gilt dies nicht für die Judikative, die dementsprechend grundsätzlich nicht gegen den demokratischen Mehrheitswilen entscheiden soll (wiederum nur, soweit dies nicht ausdrücklich in der Verfassung vorgesehen ist). Allerdings unterliegen Demokratien der Gefahr, daß machtvolle Mehrheiten politische Minderheiten absichtlich benachteiligen und entrechten. Daher ist es Aufgabe der (Verfassungs-) Gerichtsbarkeit, den demokratischen Prozeß zu bewachen (insbesondere das Recht zur Teilnahme daran), und zwar selbst dann, wenn die politischen Staatsorgane nicht ganz offensichtlich falschliegen oder die Verfassung keine ganz ausdrückliche Ermächtigung ausspricht.[16] Wiederum werden wir Zeuge einer Betonung demokratischer Verantwortlichkeit auf Kosten der verfassungsgerichtlichen Kompetenzen.
Dem Elyschen prozeßorientierten Modell quasi entgegengesetzt ist das substantiell informierte, Rechte-orientierte Modell, dessen exponiertester Vertreter wohl Ronald Dworkin ist.[17] Ausgangspunkt ist, daþ die Verfassung moralische Rechte enthält, die zwar nicht immer explizit aufgezählt sind, die aber der einzelne dem Staat und der Mehrheit entgegenhalten kann. Daher ist die Invalidation von Gesetzgebung, die diese Rechte verletzt, im Einklang sowohl mit der Verfassung selbst als auch mit den der Mehrheitsregel unterliegenden utilitaristischen Prinzipien. Gerichtlich zu wahrender Konstitutionalismus und Mehrheitsdemokratie teilen ihr Bekenntnis zur moralischen Gleichheit der Individuen. Insofern läßt sich diese Position wie folgt zusammenfassen: Die Verfassung enthält erkennbare Antworten auf die Frage, welche Rechte gegenüber der Mehrheit schutzbedürftig sind, so daß Regierungsgewalt nicht immer dann legitim ist, wenn dadurch der Mehrheitswillen gefördert wird, sondern nur dann, wenn der Mehrheitswillen gefördert wird und zugleich die Rechte des einzelnen der Mehrheit gegenüber respektiert werden. Die Entscheidung hinsichtlich der Identifikation dieser Rechte fällt nicht der Mehrheit selbst zu, sondern den der Mehrheit nicht verantwortlichen Richtern. Dworkins Rechte-orientiertes Modell kann damit zwar einerseits als Ausnahme gegenüber anderen Modellen insofern angesehen werden, als es Verantwortlichkeit zugunsten der richterlichen Identifikation von Rechten relativiert. Auf der anderen Seite wird das Problem aber verlagert auf die Frage, warum gerade Richter dazu berufen sein sollten, (moralische) Rechte des einzelnen zu identifizieren -- eine Frage, die verfassungsgerichtliche Legitimation eher noch stärker untergräbt.[18]
Die angeführten Modelle haben gemeinsam, daß sie die Institution der Verfassungsgerichtsbarkeit durch die Linse der Demokratie betrachten. Von Hans Georg Gadamer und Josef Esser kann man lernen, wie sehr Vorverständnisse die Interpretation und Analyse beeinflussen. Ein solches Vorverständnis läßt sich im Hinblick auf die Debatte um verfassungsgerichtliche Legitimität dergestalt festmachen, daß Entscheidungen in demokratischen Herrschaftssystemen grundsätzlich in der demokratischen Basis -- dem Demos -- verankert sein müssen. Es ist insofern ein Bewußtseinshorizont lokalisierbar, der demokratische Herrschaft mit demokratischer Kontrolle und Verantwortlichkeit gleichsetzt, und zwar so, daß beides gewissermaßen prioritär und der Verfassungsgerichtsbarkeit vorgängig ist. Danach kann es gar nicht genug demokratische Verantwortlichkeit geben: Ein Zuviel an demokratischer Rückbindung ist hiernach nicht vorstellbar.
Verantwortlichkeit bedeutet danach, gegenüber jemandem antworten zu müssen und Zeugnis abzulegen für Handlungen, die man begangen oder nicht begangen hat, sowie für die daraus resultierenden Konsequenzen.[19] Dadurch wird in der Demokratie eine Verbindung hergestellt zwischen formaler Autorität und den Ergebnissen der Geschichte. Verfassungsgerichtsbarkeit, durch diese Linse betrachtet, erscheint notwendigerweise als demokratisch defizitär. Verfassungsrichter und -richterinnen werden nicht direkt vom Volk gewählt.[20] Sie müssen sich keiner Wiederwahl stellen. Sie sind dem Volk nicht direkt verantwortlich. Im Gegenteil: (Verfassungs-)richterliche Unabhängigkeit garantiert gerade die Nicht-Verantwortlichkeit, die nur in Extremfällen (ß 105 BVerfGG) durchbrochen ist. Entscheidungen dieses Gremiums durchbrechen nun den Mehrheitswillen von unmittelbar gewählten und dem Volk unmittelbar verantwortlichen Repräsentanten. Es leuchtet unmittelbar ein, daß dies mit dem postulierten Grundsatz der demokratischen Verantwortlichkeit, von der es nicht zu viel geben kann, nur schwer in Einklang zu bringen ist.
Der übliche Weg aus diesem Dilemma ist der unter II. gezeigte. Wenn die beiden Pole Demokratie (oder Mehrheitsprinzip) und Konstitutionalismus (oder Verfassungsgerichtsbarkeit) als in Spannung befindlich erkannt werden[21], dann richten sich die erklärenden Bemühungen um ãEingliederung" (oder aber scharfe Kritik) auf die Institution der Verfassungsgerichtsbarkeit, während in der Tat die weitreichende, aus dem Demokratieprinzip abgeleitete Forderung, daß alle Entscheidungen popular verwurzelt und kontrolliert sein müssen, nicht angetastet wird. Der vorliegende Beitrag wählt einen anderen Weg, indem er in diesem Abschnitt eben jene grenzenlose demokratische Verantwortlichkeit einer kritischen Durchsicht unterzieht. Dabei wird im Anschluß an den ãNeuen Institutionalismus" von James March und Johan Olsen[22] gezeigt werden, daþ demokratische Verantwortlichkeit an sich keineswegs ein unzweideutiges Konzept ist -- und dies sogar abseits der Indeterminismen ý la Derrida, Foucault oder Stanley Fish.
Die Psychologie von Verantwortlichkeit.
Zunächst ist festzustellen, daþ Verantwortlichkeit[23] einen nicht zu unterschätzenden psychologischen Effekt auf diejenigen hat, die Rechenschaft für ihre Handlungen ablegen müssen und sich dafür zu verantworten haben. Eine Reihe von Studien[24] zeigt erstens, daþ Verantwortlichkeit Bedächtigkeit beim Fällen von Entscheidungen fördert. Die Informationsmenge, die in die Entscheidungsfindung einflieþt, sowie die Sorgfalt, mit der diese Informationen analysiert werden, werden durch Verantwortlichkeit vergröþert. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn die Verantwortlichkeit den Akteur trifft, bevor die Öffentlichkeit (als Instanz, gegenüber der man verantwortlich ist) ihre Präferenzen gewählt hat bzw. wenn diese Präferenzen dem oder der Handelnden unbekannt sind oder konfligieren. Vier Illustrationen sind geeignet, diesen Effekt der Entscheidungsbedächtigkeit zu verdeutlichen. (1) Normalerweise sind Menschen geneigt, Ereignisse kausal den Intentionen oder Dispositionen von Individuen anstatt situational bedingten Faktoren zuzuordnen. Diese Tendenz war in bezug auf solche Akteure reduziert, die für ihre Urteile verantwortlich gemacht wurden (fundamental attribution error). (2) Während Beurteilungen im Normalfall auf der Basis von frühen Informationen geformt und auch bei Vorhandensein späterer konträrer Fakten kaum und nur sehr langsam revidiert werden, so reduziert Verantwortlichkeit diese Effekte (primacy effect). (3) Üblicherweise überschätzen sich Entscheidungsträger dergestalt, daß sie größeres Vertrauen in ihre eigene Urteilsfähigkeit besitzen als eigentlich gerechtfertigt. Auch dieses übersteigerte Selbstvertrauen wird durch Verantwortlichkeit moderiert (confidence). (4) Im Rahmen der Meinungsbildung finden häufig Faktoren Berücksichtigung, die für die Entscheidung irrelevant sind. Hierdurch wird die Bedeutung von offensichtlich entscheidungsrelevanten Faktoren geschmälert. Diese Tendenz, die zur Verwässerung führt, wird durch Verantwortlichkeit noch gesteigert (dilution effects). March und Olsen merken zu Recht an, daß die sich zunächst aufdrängende Einteilung von (1) - (3) als positiv, (4) als negativ nicht unbeschränkt Gültigkeit besitzt: Zwar sind die Entscheidungsträger insgesamt nachdenklicher und deliberativer, aber ebenso besteht die Gefahr, daß sie häufig nach der Relevanz irrelevanter Überlegungen suchen und dadurch ihr Selbstvertrauen verlieren, das Handlung erst ermöglicht.[25]
Zweitens zieht Verantwortlichkeit größere Vorsicht in bezug auf Wandel nach sich und reduziert die Bereitschaft, Risiken auf sich zu nehmen. Mögliche Verluste scheinen schwerer zu wiegen als mögliche Gewinne. Dies sei an den folgenden vier Beispielen demonstriert. (1) Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Akteur eine Handlungsalternative wählt, ist größer, wenn diese Alternative als den status quo bewahrend umschrieben ist, als wenn sie als Wandel daherkommt. Verantwortlichkeit verstärkt diese Tendenz hin zum status quo (favored position of the status quo). (2) Alternativen mit klar vorauszusehenden Konsequenzen werden generell denjenigen vorgezogen, die das Ergebnis weniger klar erahnen lassen. Auch diese Neigung wird durch Verantwortlichkeit verstärkt (ambiguity and risk aversion). (3) Bevorzugt werden Positionen vertreten, von denen erwartet wird, daß sie für andere sozial akzeptabel sind. Das Bewußtsein, Rechenschaft ablegen zu müssen, akzentuiert diesen Hang zu sozialer Konformität (social conformity). (4) Im allgemeinen werden die Vorteile, die man sich von Kooperativität und Zusammenarbeit mit einer Gruppe verspricht, abgewogen gegen die potentiellen Verluste, mit denen man individuell identifiziert wird. Persönlich verantwortlich zu sein fokussiert einen Entscheidungsträger auf letzteres, wodurch die Bereitschaft reduziert wird, Risiken zugunsten möglicher Kooperations-Gewinne auf sich zu nehmen (uncooperativeness). Wiederum ist hervorzuheben, daß Vorsicht bei der Entscheidungsfindung weder uneingeschränkt positiv noch negativ zu bewerten ist. Jedoch ist jedenfalls zu berücksichtigen, daß Verläßlichkeit hoher Varianz vorgezogen wird, ebenso wie die Beibehaltung des status quo dem Wandel.[26]
Drittens verstärkt Verantwortlichkeit Tendenzen in Richtung auf Starrheit und einseitige Verteidigungsbereitschaft. Ein erneutes Überdenken von einmal gefällten Urteilen oder Entscheidungen findet seltener statt; ebenso konzentriert sich das Sammeln von Informationen auf solche Fakten, die die gefällte Entscheidung stützen. Zwei Illustrationen: (1) Erfahrungen und Rechtfertigungen werden zumeist so organisiert, daß sie die Richtigkeit vorangegangener Entscheidungen bestätigen. Ebenso wird Verantwortung für positive Ergebnisse in Anspruch genommen, wohingegen Verantwortung für negative Konsequenzen abgeleugnet wird. Ist letzteres unmöglich, so wird zumindest die Negativität der Konsequenzen bestritten (rationalization und self-confirmation). (2) Im Rahmen des Rechtfertigungsprozesses wird die Bindung an eine einmal gefällte Entscheidung noch verstärkt (escalating commitment). Wiederum sind erhöhte Starrheit und Verteidigungsbereitschaft nicht notwendigerweise gänzlich positiv oder negativ.
Vielmehr erhellt, daß es sich bei (demokratischer) Verantwortlichkeit -- vom motivations- und kognitionspsychologischen Standpunkt aus -- um ein durchaus zweischneidiges Schwert handelt. Zum einen wird die soziale Kontrolle verschärft, und politische Akteure werden in gößere Responsivität gegenüber Sozialdruck und Standards von sozial angemessenem Verhalten gezwungen. Auf der anderen Seite reduziert Verantwortlichkeit Risikobereitschaft, kann zum Verschieben und ãAussitzen" von Entscheidungen führen, tendiert zur Bewahrung des status quo und zu Mißtrauen gegenüber Wandel, und unterliegt schließlich der Gefahr, Fehlentscheidungen auf unabsehbare Zeit mitzuschleppen (und gleichzeitig zu verschleiern).
Deliberation und Handlung.
Verantwortlichkeit steht im Dienste der Selbst-Reflektion eines Gemeinwesens. Eine Demokratie zeichnet sich dadurch aus, daß sie die Wege und Mittel sowie ihre Ziele ständig neu überdenkt und hinterfragt, daß sie ihre Erfahrungen, ihre Methoden und Techniken, Strategien, Werte und Zwecke neu diskutiert und deliberativ erwägt. Dies wird dadurch erreicht, daß Geschichte interpretiert wird, wodurch wiederum Handlungen gerechtfertigt (oder aber verurteilt) und Verantwortlichkeiten etabliert werden. ãRechtfertigungen und Verurteilungen binden Handlung an ein gemeinsames System kausaler und normativer Auffassungen innerhalb einer politischen Kultur."[27] Hieraus wird bereits deutlich, daþ Deliberation und Selbst-Reflektion lediglich einer von zwei grundlegenden Pfeilern einer funktionierenden Demokratie ist. Die andere Seite der Medaille ist die praktische, gute und intelligente Handlung: Ñto get the job done right". Diese beiden bilden ein zwiespältiges und nicht immer einfach miteinander zu vermählendes Paar. Die Spannung zwischen ihnen ist nichts anderes als die grundlegende Spannung, der jede Herrschaftsform unterliegt. Gemeinhin wird sie als Effizienzproblem formuliert; wir meinen jedoch, daß dies bereits ein Versöhnungsversuch ist, der die grundlegende Spannung zu mildern bestrebt ist. In Anbetracht dieser Spannung ist es nun fast ein Gemeinplatz zu formulieren, daß demokratische Prozesse durch die Versuchung endloser Gespräche und nicht enden wollender Suche nach Rechtfertigung gefährdet sind. Die Balance zwischen Diskurs und effektivem Regieren und Verwalten ist eines der Schlüsselprobleme moderner Demokratien. Während es im Normalfalle so erscheint, als werde der demokratischen (diskursiven) Rechtfertigung die Priorität zugewiesen (was, nebenbei, nicht selten auf harsche Kritik stößt), zeigt sich in Krisenzeiten, etwa in Kriegs- oder Ausnahmezuständen, daß schnelle und effektive Handlung manchmal wichtiger ist als eine gründliche Debatte. Das gleiche Ergebnis spiegelt sich, nunmehr zeitungebunden, in der Existenz von Hierarchien und Befehlsgewalten wider.[28] In institutioneller Hinsicht wird Deliberation und öffentliche Rede traditionell in der Legislative angesiedelt, während die Exekutive, insbesondere die Verwaltung eher den locum agendi und der Durchführung, weniger der öffentlichen Rechtfertigung symbolisiert. Schwer zu lokalisieren ist in diesem Zusammenhang die Gerichtsbarkeit, was z.T. damit zusammenhängen mag, daþ sie selten als Teil eines politischen Verantwortungssystems begriffen worden ist.[29]
Lang- und Kurzfristigkeit.
Eng damit zusammen hängt auch eine weitere Gefahr, die demokratische Verantwortlichkeit nach sich zieht: die Vernachlässigung einer langfristigen Perspektive. Das im Grunde einfache Prinzip, daþ Entscheidungsträger dem Volk verantwortlich sind und daþ Macht durch die Zufriedenstellung der Forderungen des Volkes bedingt ist, wird dadurch verkompliziert, daþ politische Handlungen und ihre Konsequenzen ungleich über die Zeit verteilt sind. Handlungen, die kurzfristig unangemessen erscheinen und kostspielig sind, können auf lange Sicht angemessen und vorteilhaft sein. Solche Handlungen sind schwer aufrechtzuerhalten in einem System, das demokratische Verantwortlichkeit durch kontinuierliches monitoring verwirklicht. Hierin besteht ein weiteres Dilemma demokratischer Verantwortlichkeit: Demokratische Kontrolle scheint unerbittlich darauf hinauszulaufen, daß eine langfristige Perspektive bei der Entscheidungsfällung nicht angemessen berücksichtigt werden kann.[30] Wird demokratische Verantwortlichkeit also durch politischen Wettbewerb und durch kontinuierliches monitoring durchgesetzt, so ist dies gleichzeitig lebenswichtig für eine Demokratie wie auch eine potentielle Gefahr. Dieser Gefahr mag dadurch begegnet werden, daß Verantwortlichkeit strukturell eher periodisch und nachträglich anstatt kontinuierlich und vorderhand arrangiert wird. Beispielsweise könnte die Zeitspanne zwischen Wahlen vergrößert werden. Dies hätte freilich den bedeutenden Nachteil, daß die Korrektur von Fehlern stark hinausgezögert würde. Darüber hinaus scheinen moderne Demokratien ohnehin eher in Richtung kurzfristiger Perspektiven zu tendieren. Veränderungen hinsichtlich technologischer und kultureller Voraussetzungen politischer Beobachtung und politischen Verhaltens haben die Möglichkeit von Bürgern und Interessengruppen zu kontinuierlicher Kontrolle sowie kontinuierlichem politischen Wettbewerb verstärkt. Wenn praktisch jeder Schritt demokratischer Regierungsarbeit öffentlicher Aufsicht unterfällt, dann ist die Kontrolle des politischen Systems zwar auf kurze Sicht gewährleistet -- jedoch geht dies zu Lasten der langfristigen Perspektive.
Personeller Verantwortungsbereich.
Das traditionelle Verständnis von demokratischer Verantwortlichkeit geht davon aus, daß die Bürokratie gewählten Repräsentanten und diese wiederum dem Volk verantwortlich sind. Eine zeitgemäße Konzeption dagegen zielt ein umfassenderes Prinzip an: ãDas generellere Prinzip ist, daß jeder, dem in einem demokratischen Staat Macht zukommt, dem Volk für die Ausübung dieser Macht verantwortlich sein sollte."[31] Und: ÑJe gröþer die Macht, umso gröþer die Notwendigkeit der Verantwortlichkeit."[32] Dies zieht umfangreiche Folgeprobleme nach sich. Wer soll alles demokratische Rechenschaft ablegen müssen? Je stärker etwa organisierte Interessen innerhalb demokratischer Gemeinwesen wurden, desto stärker wuchs auch der Systemdruck auf sie, sich demokratisch zu verantworten.[33] Weitere Gruppen wie etwa Konsumentengruppen, Berufsgruppen, ethnisch oder geschlechtsorientierte Gruppen, Umweltgruppen und sog. Single-issue pressure groups kommen in Betracht. Darüber hinaus legt die moderne Informationsgesellschaft nahe, auch die Presse und andere Medien, Verlage und Professoren dem Wirkbereich demokratischer Verantwortlichkeit zu unterwerfen, sind sie doch auffällige Akteure im politischen System, deren öffentliche Verantwortlichkeit häufig unklar ist und in unübersehbarem Gegensatz zu ihrer öffentlichen Verantwortung steht. Sie formen Meinungen, setzen oft Werte, organisieren Interpretationen historischer Abläufe und haben häufig größeren Einfluß als Politiker. Eine weitere, besonders interessante Frage ist schließlich, ob und inwieweit der Bürger selbst demokratischer Verantwortlichkeit unterfällt oder unterfallen sollte. Unzählige Arbeiten haben gezeigt, wie sich das politische System von der Religion emanzipiert hat und wie das Volk die Götter und letztendlich auch die Monarchen als Spender von Autorität und Legitimität ersetzt hat.[34] Zugleich aber mit der Bestellung von Repräsentanten haben sich die Bürger der Verantwortlichkeit für diesen Bestellungsakt im allgemeinen entfremdet. Im Gegenzug verlangen etwa March und Olsen ein Ende der vorgeschobenen ãImmunität von Verantwortlichkeit".[35] Ob man hierbei so weit gehen darf, dem demokratischen Bürger eine ÑPflicht zur Teilnahme am bürgerlichen und politischen Leben und zur Förderung der Wohlfahrt der politischen Gemeinschaft"[36] aufzubürden, ist eine andere Frage.[37] Deutlich wird jedenfalls, daþ der Kreis verantwortlicher Akteure durchaus unterschiedlich gezogen werden kann, woraus sich weitere Zweideutigkeiten in bezug auf das Konzept der Verantwortlichkeit im demokratischen Gemeinwesen ergeben.
Ergebnis- versus Handlungsverantwortlichkeit.
Auch die Standards demokratischer Verantwortlichkeit sind keineswegs klar oder unmittelbar einsichtig. Man kann im Grundsatz zwischen zwei verschiedenen Logiken unterscheiden, nach denen Menschen für ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden können: die Logik der Konsequenzen und die Logik der Angemessenheit. Erstere führt dazu, daß sich politische Akteure für die Konsequenzen ihrer Handlungen zu verantworten haben. Diese Option ist wahrscheinlich in einer Tradition, die den Gang der Geschichte in nachhaltiger Weise durch menschliches Handeln und menschliches Entscheiden beeinflußt sieht -- Verantwortlichkeit für die Konsequenzen von Handlungen ist dann gleichbedeutend mit Verantwortlichkeit mit historischen Resultaten. Nach der Logik der Angemessenheit hingegen verantworten sich politische Akteure danach, ob ihre Handlungen angemessen sind: nicht die Konsequenzen von Verhalten sind entscheidend, sondern die Konsistenz mit kulturellen und politischen Normen und Regeln.
Die Angemessenheitslogik informiert entscheidend die Webersche Tradition und die Kultur des Rechtsstaats.[38] Beamte können dafür verantwortlich gemacht werden, daþ sie den Normen nicht folgen, die ihre Tätigkeit regulieren, nicht jedoch für nachteilige Konsequenzen, die daraus entstehen, daþ sie diesen Regeln folgen. Auf den politischen Bereich übertragen würde dies bedeuten, daß politische Akteure für die Legalität, Moralität oder die political correctness der Politiken, die sie verfolgen, verantwortlich gemacht werden. Sie werden danach gewogen, ob sie ihre Rolle mit Hingabe, Integrität und im Einklang mit den prozeduralen Erfordernissen erfüllen. Demgegenüber scheinen die modernen Demokratien des zwanzigsten Jahrhunderts mehr in die Richtung der Konsequenzenlogik zu tendieren. Effektivität, Effizienz und materielle Resultate finden größere Beachtung als die formalen Prinzipien und Prozeduren des Prozesses der Entscheidungsfindung. March und Olsen schließen hieraus, daß ãHerrschaft nunmehr eine Gemeinschaft gemeinsamer Ziele anstatt einer Gemeinschaft gemeinsamer Prinzipien und Prozeduren meint".[39] In der Praxis kommen wohl beide Verantwortlichkeitsstandards zur Anwendung. Das Bild wird dadurch verkompliziert, daþ angemessene Handlungen manchmal unerwünschte (d.h. uneffektive, ineffiziente, kontraproduktive, teure etc.) Ergebnisse zeitigen, während ãgute" Ergebnisse manchmal durch Handlungen erreicht werden, die nicht im Einklang mit prozeduralen Normen und Prinzipien stehen.
Persönliche Verantwortlichkeit als Komplexitätsreduktion.
Schließlich soll noch Erwähnung finden, daß die Feststellung persönlicher Verantwortlichkeit für den Lauf der Geschichte allzu häufig eine (unzulässige) Vereinfachung der tatsächlichen Sachlage darstellt. Zwar erscheint es zunächst als offensichtlich, Individuen für den Fall, daß die Dinge schlecht gehen, mangelnder Intelligenz oder Kompetenz oder schlechter Absichten zu bezichtigen, ebenso wie es uns natürlich erscheint, Individuen als tugendhaft und kompetent zu bewundern, wenn alles gut geht. Dies wird jedoch der Komplexität von Verantwortlichkeiten im modernen Staat nicht gerecht. Zum einen gibt es eine Vielzahl politischer Akteure, die durch komplizierte und komplexe Verbindungen miteinander verschaltet sind. Politik ereignet sich auf dem Hintergrund von Bindungen, die von anderen eingegangen wurden, von Strukturen, die nicht selbst gewählt, sondern bereits vorher festgelegt worden sind, und von Entscheidungen, die sich in den seltensten Fällen auf eine bestimmte Person (oder sogar Institution, denn auch diese finden sich in komplexe Strukturen eingebunden) zurückverfolgen lassen. Zum zweiten ist die Kausalität von Ereignissen häufig fraglich, so daß insgesamt der Beitrag, der von Menschen geleistet wird, schwerlich zu isolieren und als solcher feststellbar ist. In einer polyzentrischen Gesellschaft[40], in der Entscheidungsprozesse in networks ablaufen, lassen sich die Beiträge menschlichen Ursprungs von anderen historisch bedingten Faktoren schwer trennen. Nach Anthony Giddens sind wir eingetreten in ein Ñneues und verstörendes Erfahrungsuniversum", in dem wir ÑGeschichte nicht einfach packen und gemäþ unseren Zwecken beugen können".[41] Zum dritten schlieþlich sind die Standards, nach denen Ergebnisse und Verantwortlichkeiten gemessen werden, reichlich obskur. Dieser Punkt geht über das hinaus, was unter der Überschrift ãErgebnis- versus Handlungsverantwortlichkeit" behandelt wurde. Sogar innerhalb beider Verantwortlichkeitskategorien sind die Kriterien alles andere als eindeutig. Auch verlangen politische Mandate, Rechte, Ziele und Normen Interpretationen.[42] So sind etwa historische Erzählungen niemals eine Aneinanderreihung von Fakten, sondern deren Lokalisierung in einem bestimmten Bedeutungszusammenhang, welcher wiederum bewertender oder zumindest erläuternder (also interpretatorischer) Art ist.
Warum Verantwortlichkeit?
Während die obigen Ausführungen den Schatten der Zweideutigkeit auf das Prinzip der Verantwortlichkeit werfen, ist es natürlich keinesfalls das Ziel dieser Argumentation, Verantwortlichkeit an sich und grundsätzlich in Frage zu stellen. Zweideutigkeit bedeutet ja nicht Überflüssigkeit; das Gegenteil trifft häufig zu.[43] Zweideutigkeit trägt etwa dazu bei, bestimmte Konzepte erst attraktiv werden zu lassen. Nehmen wir eine weitere kleine Paradoxie der Idee der Verantwortlichkeit: In ihr fallen Freiheit und Kontrolle zusammen. Verantwortlichkeit dient einerseits zweifellos als Instrument sozialer Kontrolle -- andererseits verbindet sich mit ihr auch das Bewußtsein persönlicher Freiheit. Wer nicht verantwortlich ist (zum Beispiel minderjährige Kinder, entmündigte Menschen), ist zugleich ein nicht vollständiges menschliches Wesen; es fehlt ein entscheidender Teil. Diesen Teil können wir als Freiheit der Wahl und Freiheit des Handelns identifizieren -- Verantwortlichkeit erzeugt eine Vermutung dergestalt, daß diese Freiheit gegeben ist.[44]
Demokratische Verantwortlichkeit besitzt eine Vielzahl von Funktionen und Tugenden, die erklären, warum auch moderne Gesellschaften und politische Systeme trotz der beschriebenen Zweifel an dieser Konzeption festhalten. Diese Funktionen (und Tugenden) gehen über das hinaus, was gemeinhin mit demokratischer Verantwortlichkeit assoziiert wird, nämlich die Anbindung von politischen Entscheidungen an die demokratische Basis.
Nach einem Erklärungsmodell handelt es sich bei der Zuordnung persönlicher Verantwortlichkeit lediglich darum, Geschichte im Einklang mit traditionell festgeschriebenen Narrationsmustern zu erzählen. Deren Struktur ist (zumindest seit der Aufklärung) so gestaltet, daß geschichtliche Abläufe durch den Menschen, seine Handlungen und Entscheidungen nicht nur maßgeblich beeinflußt, sondern in der Tat kontrolliert werden. Daher üben in diesen Erzählungen Individuen Kontrolle über das Schicksal aus, und die Geschichte wird bewohnt von Helden und von Schurken -- obwohl jeder sehr wohl weiß, daß es solcherart Helden und Schurken nicht gibt. Dieser Erzählungsrahmen wird dann in Einzelfällen revidiert und differenziert, wenn es um weniger entfernte Personen oder Ereignisse geht. Im Normalfall jedoch wird diese Erzählstruktur aufrechterhalten; ob der einzelne eigentlich weiß, daß diese Struktur so nicht zutrifft, spielt keine Rolle. Somit wird Verantwortlichkeit zum Mythos. March und Olsen vergleichen dies mit elterlichen Geschichten vom Nikolaus.[45]
Eine zweite Deutungsmöglichkeit besteht darin, daß die Komplexität von Geschichte und Kausalzusammenhängen durchaus als kognitives Allgemeingut anerkannt wird. Man weiß um all die Zweideutigkeiten von Verantwortlichkeit. Doch was würde geschehen, wenn man ihre Einführung in den politischen Diskurs einfach zuließe? Die Zweifel am Konzept, ja die Komplexität von Geschehnisabläufen selbst würde als leichte Entschuldigung für Untätigkeit und politische Fehler herhalten müssen. Demokratische Verantwortlichkeit sichert aus dieser Perspektive mithin politische Motivation: politische Akteure werden dazu motiviert, immerhin das zu tun, was ihnen möglich und gut erscheint.
Eine dritte Erklärung dafür, daß demokratische Verantwortlichkeit einen so unangefochtenen Platz in der politischen Theorie und Praxis innehat, greift weiter aus als die beiden zuvor genannten, die eher praktischer Natur sind. Es handelt sich hierbei um eine Funktion, die ich menschliche Selbst-Affirmierung nennen möchte und die verdeutlicht, daß Verantwortlichkeit mehr impliziert als lediglich Kausalität. Das Etablieren von persönlicher Verantwortlichkeit dient dazu, die Überlegenheit von willensgesteuerter menschlicher Handlung gegenüber dem Fluß der Geschichte zu beteuern. Damit reichen die Wurzeln von Verantwortlichkeit tief. Zum einen wird etwa die Bedeutsamkeit menschlichen Wählens und Entscheidens unwiderleglich behauptet. Insofern stellt sich das Konzept der Verantwortlichkeit als -- quasi Kantianische -- Verteidigungslinie gegenüber den beunruhigenden Ergebnissen der social choice-Theorie dar, die seit den Forschungen des Nobelpreisträgers Kenneth Arrow nachgewiesen hat, daß die einfache Mehrheitsregel unter bestimmten Bedingungen nicht in der Lage ist, eindeutige Resultate zu zeitigen.[46] Zum anderen öffnet der Mythos von der unumschränkten Einfluþmacht des Menschen (des Politikers?) auf die Geschichte die Tür zu Entwürfen vom Fortschritt der Geschichte. Fortschritt und Hoffnung figurieren an exponierter Stelle in zeitgenössischen Narrationen nur, weil der Mensch sein Schicksal kontrolliert, weil er, wenn er ãverantwortungsbewußt" handelt und entscheidet, Held und Retter sein kann. Ein Vehikel dieser Konstruktion ist die demokratische Verantwortlichkeit.
Die unbeschränkte Institutionalisierung demokratischer Verantwortlichkeit stellt mithin durchaus ein zweischneidiges Schwert dar. Warum ist dann der "Verantwortlichkeits-Diskurs" in den modernen Demokratien so grenzenlos? Ebenso könnten wir fragen, warum der Diskurs um politische Werte zwischen den Parteien auf einem so allgemeinen Niveau geführt wird, daß er nicht nur nichtssagend geworden ist, sondern sogar kaum noch politische Abgrenzungen zuläßt und die Parteien in nicht zu unterschätzende Profilierungsschwierigkeiten bringt. Möglicherweise lassen sich diese und eine Vielzahl anderer Phänomene auf die verzweifelte Suche nach Konsens zurückführen, der dem säkularen Staat und der entmystifizierten Nation die Integration erlaubt -- eine ausführliche Analyse aber kann an dieser Stelle nicht geleistet werden.[47] Was vorliegend von Wichtigkeit ist, ist die unbestreitbare Tatsache, daþ jener "Verantwortlichkeits-Diskursî kaum durchbrochen werden kann -- auch von diesem Beitrag nicht. Wir haben weiterhin gesehen, daþ dies zumindest zum Teil auch gut so ist, da Verantwortlichkeit (neben dem Offensichtlichen) wichtige gesellschaftliche Funktionen erfüllt. Gleichzeitig aber wird Verantwortlichkeit dazu benutzt, das Bundesverfassungsgericht in Frage zu stellen. Worte vom Richter-Aeropag in Karlsruhe, gar vom Justiz-Staat schweben nicht frei im Raum, sondern stehen fest verwurzelt auf dem Boden eben jenes Diskurses.
Das Verfassungsgericht befindet sich angesichts solcher Kritik in einem Dilemma: Weder kann es den Vorwurf der -- im Vergleich zur Legislative -- defizitären demokratischen Legitimation entkräften, noch kann es erhoffen, den Verantwortlichkeitskonsens zu erschüttern. Wie kann in dieser scheinbar aussichtslosen Lage eine tragbare Verteidigung aussehen? Der an und für sich unmittelbar einsehbare funktionale Hinweis, daß der Schutz von Minderheitenrechten ebensowenig einem der Mehrheit verantwortlichen Organ anvertraut werden darf, wie man einen Bock zum Gärtner machen sollte, weist zwar auf das Spannungsverhältnis zwischen Demokratie und Konstitutionalismus hin, löst aber unser Problem nicht zufriedenstellend: Zum einen polarisiert er die Spannung, anstatt sie aufzulösen; zum anderen wirft er beim Versuch der Lösung eines Legitimationsproblems gleich eine Reihe anderer mit auf, etwa: Warum sind gerade die Richter in besonderer Weise dazu qualifiziert, Minderheitenrechte zu wahren? Wie kommt es, daß vor Jahrzehnten (d.h. von einer ganz anderen Mehrheit als heute) festgesetzte Minderheitsrechte heutige Mehrheiten binden?, usw. Die funktionale Betrachtung, so zutreffend sie ist, hilft dem Gericht nicht viel, ja sie leitet nicht einmal die Legitimationsprobleme in institutioneller Hinsicht um, da etwa die neu aufgeworfene Frage, warum gerade Richter besonders qualifiziert seien, mindestens so stark an der verfassungsgerichtlichen Autorität nagt wie das Problem der defizitären Verantwortlichkeit.
Eine zuverlässigere Verteidigungslinie bietet die (bereits oben kritisch angerissene) Trennung zwischen Recht und Politik. Wie bereits angedeutet[48], können wir sie als in einem "Mythos der unbefleckten Wahrheitî verwurzelt betrachten. Zwar werden demokratischer Konflikt und demokratisches Handeln und Verhandeln nicht nur anerkannt, sondern (als Pluralismus oder Neo-Pluralismus, heute insbesondere Fraenkelscher Prägung) auch als wünschenswert postuliert, doch daneben existiert eben noch etwas anderes -- die Wahrheit -- als ein aliud außerhalb jener demokratischen Instrumente. Sie wird nicht verhandelt, entzieht sich Kategorien wie Konsens, Konkordanz, Konkurrenz oder Partizipation, und kann "gefunden" werden. Das Recht ist Teil dieser Sphäre: Es ist Wissen, und als solches erkennbar, auffindbar durch rationale, objektive Kriterien. Selbst wenn dies nicht immer so deutlich formuliert wird wie durch Ernst-Wolfgang Böckenförde[49] (was u.a. daran liegen mag, daþ auch Juristen des postmodernen Trends gewahr werden, Objektivität durch Konstruktion und Relativismus zu ersetzen), so spiegelt sich dieser Mythos doch allerwegen wider. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten von Amerika etwa, wo die Verfasser rechtsbezogener Aufsätze keine Hemmungen haben, unmiþverständlich deutlich zu machen, daþ es sich bei ihrem Beitrag eben um ihre ganz persönliche Auffassung handelt, ist die erste Person Singular in deutschen rechtswissenschaftlichen [sic!] Veröffentlichungen praktisch tabu. Das Passiv ("Dadurch wird klargestellt, daß..."), Unausweichlichkeits-Semantiken ("Es ist mithin festzustellen, daß...") und die inflationäre Personalisierung von Dingen oder Konzepten ("Der Grundsatz der Glaubensfreiheit verlangt, daß..."; "Der Beitrag stellt klar, daß...") verdrängen jegliches individuelle Subjekt aus dem Recht[50] und tragen dazu bei, eine Aura der Objektivität um das Recht herum aufrechtzuerhalten.[51] Deutlicher kann es sich nicht mehr vom politischen System abheben. Ebenso wird häufig etwa jegliche Geschichtlichkeit subtil in Abrede gestellt. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts etwa werden gemeinhin ohne den Zusatz der Jahreszahl zitiert, in denen sie erlassen wurden, wiederum anders als im anglo-amerikanischen Raum. Hierdurch wird der geschichtliche Entstehungszusammenhang verschleiert; alle Entscheidungen unterliegen nunmehr -- historisch nicht mehr unmittelbar einordnungsfähig -- einer Nivellierung, die das Verfassungsrecht, das ja unbestritten zum allergrößten Teil durch die Verfassungsrechtsprechung geprägt ist, in einen Zustand "permanenter Gegenwart" und somit allgemeiner Gültigkeit versetzt.[52]
Wir können den Wahrheitsmythos als naiv belächeln oder mit ärgerlicher Geste verwerfen -- jedoch können wir nicht in Abrede stellen, daß er ungewöhnlich stabilisierende, ja sogar konfliktvermeidende Wirkungen zeitigt. Zum einen zivilisiert er die Diskussion und reduziert in erheblichem Maße das Potential für Konflikt, Gewalt und unauflösbare Konfrontation, indem er die Sprache des Konflikts durch die Sprache wissenschaftlicher Untersuchung ersetzt. Niklas Luhmann stellt eben diesen Effekt fest, wenn er vor Kommunikation im moralischen System warnt (und dieses Anliegen funktionell der Ethik anträgt).[53] Wir können leicht die Parallele zur Verfassung und deren Politisierung ziehen, da -- worauf bereits mehrfach hingewiesen wurde -- Verfassungsstreitigkeiten (wie auch moralische Kommunikation) in besonderem Maþe der Gefahr unterliegen, über Konflikte als Totalität zu entscheiden. Mischurteile sind häufig nicht angebracht (oder werden im politischen System und in der Gesellschaft aufgrund der Form der Medienverarbeitung nicht als solche rezipiert), und stattdessen werden Urteile von Achtung und Mißachtung gefällt. Verfassungsstreitigkeiten geraten darüber hinaus allzu leicht tatsächlich in die Gewässer moralischer Kommunikation und somit von Überattribution, was in der wertemäßigen (und mithin moralischen) Aufladung der Verfassung begründet liegt. Neben dieser Zivilisationsfunktion gibt das Wissen im allgemeinen und das Recht im besonderen (das ja nach dieser Lesart zur gleichen Sphäre gehört) vor, der Wahrheit zu dienen, nicht aber der Macht oder dem Mammon. Dadurch stellt es eine Art Gegengewicht dar zur ungleichen und ungerechten Verteilung von monetären und sonstigen physischen Ressourcen.[54] Schlieþlich sichert der Mythos funktionell die Autorität gerichtlicher Entscheidungsmacht. Die Abtrennung der Gerichte von Parteipolitik und Parteilichkeit etabliert rechts-professionelle Standards als Basis ihrer Autorität. Insoweit sind Gerichte -- unter dem Aspekt der "bewußten Abstinenz" -- der kultur- und gesellschaftshistorisch einmaligen Stellung von Eunuchen in einem Harem vergleichbar.[55] Angemerkt sei insoweit noch zum einen, daþ es hierbei nicht um eine im Vergleich zu politischen Diskursen höhere Rationalitätsvermutung juristischer Diskurse geht, von denen Jürgen Habermas spricht.[56] Diese mag vorliegend dahingestellt bleiben -- ich spiele allein auf den als eher äußerlich zu bezeichnenden Zivilisierungs- und Integrationseffekt des Wahrheits-, Wissenschafts- und Rechtsmythos an.[57] Zum anderen ist es natürlich auch nicht so, daþ wissenschaftlicher Diskurs tatsächlich Wertfreiheit bedeutet. Wie uns etwa Walter Metzger belehrt, verschreibt sich jener Diskurs Werten wie Toleranz und Ehrlichkeit, Öffentlichkeit, Individualität und Bereitschaft zur Zusammenarbeit, Universalismus und Neutralität. Zugleich aber fordert er, daþ "Wissenschaft die Ideologie transzendieren" müsse und der Wissenschaftler "alles von sich weisen muß, was seine Leidenschaft für die Wahrheit korrumpiert".[58]
Als Teil des Wahrheitsmythos stellt diese Form des Rechtsdiskurses zugleich eine Form von Expertise, von Expertenwissen dar. Als solches identifiziert es die Position, die Recht und Politik strikt trennt, als "Progressivismus". Dieser zeichnet sich u.a. durch seinen Fokus auf aufgeklärter öffentlicher Politik im öffentlichen Interesse aus. Danach ist das gut ausgebildete und zivilisierte Individuum durchaus in der Lage festzustellen, was das beste für das Interesse der Gesellschaft als ganzer ist. Überzeugung, Diskussion, Dialog, Deliberation -- all dies figuriert als Teil des gemeinsamen Ideologiesystems moderner demokratischer Gesellschaften, nämlich des Glaubens an Rationalität und Vernunft. Dagegen empfindet der Progressivismus solche Dinge wie "Volkszorn", "Volksempfinden" etc. als suspekt, da sie aller Wahrscheinlichkeit nach zu überhasteten und irrationalen Einschätzungen und Entscheidungen führen werden. Aus diesem Grund ist es wichtigste Aufgabe, den Bürger zu erziehen und alle uninformierten, möglicherweise gar passionierten Gefühle umzuleiten und abzuschwächen. Während der "Populismus"[59], die dem Progessivismus entgegengesetzte Bewegung, Machtkonzentration und -zentralisation (sei sie öffentlicher oder privater Art) als gröþte Bedrohung empfindet, liegen die Gefahren für demokratische Herrschaft aus der Sicht des Progressivismus woanders: nämlich in einer verengten Blickweise, in Ignoranz, in der Fixierung auf eigene Interessen, in uninformierter Selbstbezogenheit. Daher ist auch eine zentrale Autorität notwendig, um bestimmte Probleme zu lösen. Gleiches gilt für Expertenwissen:
"Expertenwissen [immer nach den Progressivisten] ist absolut nicht etwas, dem zu mißtrauen wäre; im Gegenteil, es ist ganz besonders zu preisen. Expertenwissen ist notwendig, um vernünftige politische Entscheidungen zu fällen; umgekehrt gilt, daß sein Fehlen den einfachen Bürger häufig dazu verführt, Probleme mißzuverstehen und Entscheidungen zu fällen, die nicht im öffentlichen Interesse liegen. Aufgrund seines Respektes für Expertenwissen hat sich der Progessivismus immer schon mit Eliten-Diskurs gut anfreunden können. Progressivismus ist die natürliche Heimat für Reformer, die Angehörige der politischen, akademischen und sozialen Eliten sind."[60]
Jack Balkin führt unsere Betrachtung des Bundesverfassungsgerichts (und, im weiteren Sinne, der Staatsrechtslehre) in die richtige Richtung. Das Miþtrauen gegenüber dem Volk, das im Grundgesetz, in manchen Strömungen der deutschen Verfassungsrechtslehre und in der Verfassungsrechtsprechung spürbar ist und das meistenteils mit Hinweis auf die "Lehren von Weimar" gerechtfertigt wird, hat seine tieferen Wurzeln in dem Bedürfnis der politischen und rechtlichen Eliten, das deutsche Volk zu einem demokratischen und verläßlichen Demos zu erziehen. Hieraus erklärt sich auch das manchmal geradezu leidenschaftliche Anliegen, die Hegelsche Trennung zwischen (sittlichem) Staat (als Sphäre des universellem Altruismus) und Gesellschaft (als demgegenüber egoistischer Sphäre) weiterzubehaupten. Ist dies die Ausgangsposition, so nimmt es nicht wunder, daß plebiszitäre Partizipation auf Mißtrauen stößt. Ist die politically correct Begründung hierfür nunmehr die Notwendigkeit von Effektivität im modernen Massenstaat[61], so sind die tieferen Gründe wohl in dem dumpfen Gefühl anzusiedeln, daþ populare Auffassungen sorgfältig gefiltert, geläutert und durch einen weisen Staat gemanaged werden müssen. Hinzu kommt, daß gerade in Deutschland das Bewußtsein von den Gefahren mitschwingt, die von einer nicht ausreichend demokratisch eingestellten Gesellschaft ausgehen können (wobei -- dies nebenbei bemerkt -- die historische Rolle der Eliten augenscheinlich weniger lang anhaltenden Eindruck hinterlassen hat als die des Volkes; es handelt sich hierbei um eine der vielen Irrationalitäten einer spezifisch deutschen Ausprägung des Progressivismus).
Fangen wir einmal an, das progressivistische Credo des Bundesverfassungsgerichts freizulegen, so fördern wir zugleich eine Reihe von Ungereimtheiten zutage. So verträgt sich etwa der vom Verfassungsgericht gepflegte Pluralismus-Diskurs kaum mit der Vorstellung eines läuternden Staates.[62] Ebensowenig leuchtet ein, warum der Erziehungsauftrag, den sich das Gericht selbst gesetzt hat, ausgerechnet durch einen stark professionalisierten Rechtsdiskurs erfüllt werden können sollte. Weiterhin erscheint es zumindest im Ansatz paradox, daþ das Verfassungsgericht (dem ja ein demokratisches Legitimationsdefizit vorgeworfen wird) sich als Lehrer und (auch moralischer) Experte in Sachen Demokratie versteht. Schließlich, und möglicherweise am wichtigsten, ist das Erziehungsziel selbst ein Faß ohne Boden, ein endloses Unterfangen -- und insofern aber zugleich auch eine nie versiegende Quelle zur Rechtfertigung von rationaler und vernunftorientierter Läuterungstätigkeit, die der Populismus als paternalistisch empfindet. Wann ist ein Volk ausreichend und verläßlich demokratisch? Ist kollektive demokratische Grundüberzeugung meßbar? Wie kann man sie feststellen? Angesichts dieser Unsicherheiten gilt für Progressivisten nach wie vor das, was man zynisch als "Unmündigkeitsvermutung" bezeichnen könnte: eine historisch nachweisbare, möglicherweise bis zu Luther verfolgbare, zumindest aber im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und schließlich während der Zeit des Nationalsozialismus sich verheerend auswirkende totalitäre, autoritäre Disposition des deutschen Volkes, die es als gefährliches, kaum guten Gewissens eingehbares Wagnis erscheinen lassen muß, das Volk in direkter, ungefilterter Weise am politischen Prozeß teilnehmen zu lassen. Natürlich -- dies mit dem Historiker Karl Dietrich Bracher als selbstverständliches caveat -- ist es nicht ausreichend, "allgemein über den Charakter des deutschen Volkes zu räsonieren und in einem historischen Streifzug von Luther über Bismarck bis Hitler die deutsche Anfälligkeit für Diktatur und Untertanengesinnung zu entdecken."[63] Dementsprechend gilt es, einseitige und vor allem statische Geschichtsdeutungen zu vermeiden, auch (und gerade) als subtile und nicht immer offenliegende Vorverständnisse der Rechtswissenschaft.
Schließt sich an dieser Stelle der Kreis auf eine ganz unerwartete Art und Weise? Ist es nicht möglich, daß die deutsche rechtswissenschaftliche Forschung und Praxis, historisch informiert, längst in dem Bewußtsein der Zweischneidigkeit demokratischer Verantwortlichkeit operiert? Hat die Skepsis gegenüber der Maturität des deutschen Demos die Konzeptionen der repräsentativen Demokratie, des Parteienstaates und letztlich auch der starken Verfassungsgerichtsbarkeit angeregt, zumindest aber angereichert, und mithin zumindest de facto demokratische Verantwortlichkeit begrenzt? Wir können diese Fragen nicht endgültig entscheiden. Sollte jedoch zumindest ein Körnchen Wahrheit in dieser Vermutung liegen, so muß es uns ein Anliegen sein, dies kritisch aufzudecken. Es ist durchaus legitim, demokratische Verantwortlichkeit als unantastbares Alles-oder-nichts-Konzept in Frage zu stellen. Wie unser Beispiel der Verfassungsgerichtsbarkeit zeigt, ist dies sogar wünschenswert und notwendig. Eine solche Unternehmung aber darf nicht durch ein unausgesprochenes, verborgenes Geschichtsbewußtsein angeleitet sein, sondern kann nur auf der Basis von interdisziplinär informierten, offen zu Tage tretenden Überlegungen geschehen. Sollten funktionale Gesichtspunkte die fällige Abwägung dann dahingehend orientieren, daß die Skepsis gegenüber direkt-demokratischen Prozessen -- aus welchen Gründen auch immer -- berechtigt ist, so ist das Prinzip der ubiquitären demokratischen Verantwortlichkeit in der Tat ganz bewußt zu relativieren. Sollte die Abwägung jedoch anderes ergeben, so muß sich das Verfassungsgericht (ebenso wie die Forschung) die Frage stellen lassen, ob der status quo demokratischen Anforderungen entspricht. Dabei gerät zudem das Problem in den Blick, ob es tatsächlich ausreichend ist, eine Abgrenzung und anschließend möglicherweise eine Machtverschiebung zwischen Bundesverfassungsgericht und Parlament einzufordern[64], wie es in Deutschland von "Reformernî getan wird, oder ob dies nicht die Hegelsche Konzeption des sittlichen, altruistischen Staates gegenüber einer egoistischen Gesellschaft unangetastet lieþe. M.E. bietet eine Machtverschiebung vom Verfassungsgericht auf die Zivilgesellschaft eine viel aussichtsreichere Perspektive, die wirkliche Pathologie zu bekämpfen, anstatt an den Symptomen zu kurieren. Das Recht läuft sonst Gefahr, in einen unauflöslichen Dualismus zwischen Theorie und Praxis zu verfallen, den Paul Kahn in bezug auf die Unvereinbarkeit von Autorität und (diskursiver) Gemeinschaft beschreibt.[65] Allerdings ist ein gradueller Machtübergang von der staatlichen Sphäre auf die Zivilgesellschaft nicht nur Stoff für weiterführende Artikel und Ðberlegungen, sondern natürlich auch ein langfristiges Projekt. In der Zwischenzeit könnte ein klarer Blick auf das Konzept der Verantwortlichkeit hilfreich sein.