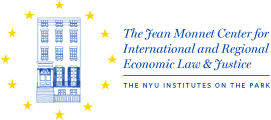
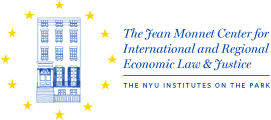 |
1. Visiting Researcher am European Law Research Center, Harvard University, Cambridge (Mass.), USA. Alle Übersetzungen aus dem Englischen sind die meinigen, soweit nicht anders vermerkt. Für hilfreiche Anmerkungen zu früheren Entwürfen danke ich den Professoren Rolf Grawert und Winfried Brugger sowie ganz besonders Professor Dieter Grimm.Den Professoren Jack Balkin und Paul Kahn danke ich für viele lehrreiche Diskussionen dieses Themas, Dipl.-Psych. Hartwig Fuhrmann für die kritische Überprüfung der Thesen zur 'Psychologie von Verantwortlichkeit'.Ohne die Anregungen und die äußerst großzügige Unterstützung in jeder Hinsicht durch Professor J.H.H. Weiler wäre dieser Aufsatz nicht entstanden; mein Dank gilt in erster Linie ihm.
3. Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803).
4. Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Eigenart des Staatsrechts und der Staatsrechtswissenschaft, in: ders., Staat, Verfassung, Demokratie, Frankfurt/M. 1991, S. 11-28, auf S. 27 bzw. 19.
5. Alexander M. Bickel, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics, New Haven/ London 1962. Die neuere US-amerikanische Literatur arbeitet bis heute unter diesem Paradigma des Verfassungsrechts. Jedoch mehren sich die Stimmen, die diesem Fokus kritisch gegenüberstehen: Vgl. etwa Erwin Chemerinsky, The Price of Asking the Wrong Question: An Essay on Constitutional Scholarship and Judicial Review, 62 Texas Law Review 1207 (1984), auf S. 1207 ("obsession of constitutional law scholarship"); Barry Friedman, Dialogue and Judicial Review, 91 Michigan Law Review 577 (1993), auf S. 578 ("constitutional scholars have been preoccupied, indeed one might say obsessed, by the perceived necessity of legitimizing judicial review"); Bruce A. Ackerman, The Storrs Lectures: Discovering the Constitution, 93 Yale Law Journal 1013 (1984), auf S. 1016 ("Hardly a year goes by without some learned professor announcing that he has discovered the final solution to the countermajoritarian difficulty, or, even more darkly, that the countermajoritarian difficulty is insoluable.").
6. Alfred Rinken, in: Alternativkommentar zum Grundgesetz f¸r die Bundesrepublik Deutschland, Neuwied 1989, vor Art. 93, Rdnr. 91.
7. Zum letzteren insbes. Christine Landfried, Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber: Wirkungen der Verfassungsrechtsprechung auf parlamentarische Willensbildung und soziale Realität, Baden-Baden 1984, etwa S. 47 ff., 125 ff.; dies., Constitutional Review and Legislation in the Federal Republic of Germany, in: dies. (Hrsg.), Constitutional Review and Legislation: An International Comparison, Baden-Baden 1988, S. 147, auf S. 157-161; dies., Germany, in: C. Neal Tate/Torbjörn Vallinder (Hrsg.), The Global Expansion of Judicial Power, New York/ London 1995, S. 307 ff.; Jürgen Jekewitz, Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber - Zu den Vorwirkungen von Existenz und Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in den Bereich der Gesetzgebung, Der Staat 19 (1980), 354 ff.
8. Etwa: Winfried Brugger, Grundrechte und Verfassungsgerichtsbarkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika, Tübingen 1987; ders., Wertordnung und Rechtsdogmatik im amerikanischen Verfassungsrecht, in: Ralf Dreier (Hrsg.), Rechtspositivismus und Wertbezug des Rechts. Vorträge der Tagung der deutschen Sektion der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie in der Bundesrepublik Deutschland, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie Beiheft 37, Stuttgart 1990, S. 173-192; ders., Verfassungsstabilität durch Verfassungsgerichtsbarkeit? Beobachtungen aus deutsch-amerikanischer Sicht, in: Staatswissenschaften und Staatspraxis 1993, S. 319 ff.; ders., Verfassungsinterpretation in den Vereinigten Staaten von Amerika, JöR N.F. 42 (1994), S. 571-593.
9. Ich wähle mit Absicht eine eher vorsichtige Formulierung. Insbesondere die neuere US-amerikanische Literatur meldet Zweifel daran an, ob das Begriffspaar ìmajoritarianism - countermajoritarianismî der Komplexität moderner gesellschaftlicher und staatlicher Entscheidungsprozesse gerecht werden kann. Aufschluþreiches Beispiel in dieser Richtung ist die Analyse von Barry Friedman, Dialogue and Judicial Review (oben Anm. 5). Friedman unterscheidet "substance majoritarianism" und "process majoritarianism"; ersteren wiederum unterteilt er in "result majoritarianism" und "source majoritarianism". Mit Hilfe dieser Kategorien gelingt es ihm, das hergebrachte Bild der Gerichte als "countermajoritarian force" zu unterminieren. "Substance majoritarianism" zielt auf die Frage, ob Gerichtsentscheidungen materiell der Mehrheitsregel zuwiderlaufen. Hier können zwei analytische Ebenen unterschieden werden. Zum einen mag das Ergebnis der Entscheidung den Mehrheitspräferenzen widersprechen (Problem des "result majoritarianism"); zum anderen spielen die Quellen der gerichtlichen Entscheidung, insbesondere ihre prozedurale Herkunft, eine wichtige Rolle (Problem des "source majoritarianism"). In bezug auf ersteres stellt Friedman fest, daß Meinungsumfragen keineswegs dafür sprechen, daß die überwiegende Zahl der Gerichtsentscheidungen der öffentlichen Mehrheitsmeinung widersprechen (607 ff.). In bezug auf letzteres gelangt er zu dem Ergebnis, daß sich Gerichte häufig den Vor-Entscheidungen mehrheitlicher Institutionen (wie etwa der Einschätzungsprärogative des Parlaments in der deutschen Verfassungsrechtsprechung) unterwerfen ("deference to governmental decisions") und auch bei der Ausformung konstitutioneller Rechte mehrheitliche Quellen zu Rate ziehen (590 ff.). "Process majoritarianism" dagegen zielt auf die Frage, ob Gerichte in der Tat der Mehrheit nicht verantwortlich sind. Hierbei spielt eine wichtige Rolle, daß in manchen Staaten die Richter gewählt werden (zu diesem Aspekt auch Steven P. Croley, The Majoritarian Difficulty: Elective Judiciaries and the Rule of Law, 62 The University of Chicago Law Review 689 [1995]). Auch der Prozeß der Ernennung von Richtern und Richterinnen durch demokratisch ihrerseits verantwortliche Institutionen relativiert das Konzept von der Mehrheit nicht verantwortlichen Judikative (609 ff.). Insgesamt wird bezweifelt, ob der Unterschied zur Repräsentation der Mehrheit in den unmittelbar gewählten demokratischen Institutionen wirklich so groß ist wie allgemein angenommen, was mit Zweifeln an deren Repräsentativität zusammenhängt. All diese Zweifel lassen sich nicht unmittelbar von der Hand weisen. Auch in bezug auf das Bundesverfassungsgericht bestätigen sich viele der amerikanischen Befunde. Vor allem angesichts der Krise der Repräsentation auch in unmittelbar vom Volk gewählten Institutionen scheint die Folgerung legitim, daß der analytische Schwerpunkt der "countermajoritarian difficulty" nicht auf der Tatsache der unmittelbaren Wahl, sondern der Verantwortlichkeit liegen sollte. So ist denn auch m.E. Friedmans Analyse dort am wenigsten überzeugend, wo er die Auffassung vertritt, daß die Gerichtsbarkeit als Institution im Grunde verantwortlich sei ("Seen as an institution, the judiciary appears accountable." S. 613 f., das Zitat auf S. 614).
10. Robert H. Bork, The Tempting of America: The Political Seduction of the Law, New York et al. 1990. Vgl. auch William H. Rehnquist, The Notion of a Living Constitution, 54 Texas Law Review 693 (1976).
11. Mark V. Tushnet, Judicial Review, 7 Harvard Journal of Law and Public Policy 77 (1984), auf S. 77. Ebenso etwa Erwin Chemerinsky, Interpreting the Constitution, New York 1987, S. 11 f. (ÑDiejenigen, die Verfassungsgerichtsbarkeit angreifen, m¸ssen entweder f¸r die Abschaffung aller richterlicher Kontrolle argumentieren, oder aber die Hauptvoraussetzung ihrer Argumentation im Stich lassen (nämlich daß alles Entscheidungen in einer Demokratie der Kontrolle durch Institutionen und Individuen unterworfen sein müssen, die durch Wahlen verantwortlich sind)."
12. Mark V. Tushnet, The Dilemmas of Liberal Constitutionalism, 42 Ohio State Law Journal 411 (1981), auf S. 425 f.
13. Bickel, The Least Dangerous Branch (oben Anm. 5), etwa S. 24.
14. Bruce A. Ackerman, The Political Case for Constitutional Courts, in: Bernard Yack (Hrsg.), Liberalism Without Illusions - Essays on Liberal Theory and the Political Vision of Judith N. Shklar, Chicago/London 1996, S. 205; ders., We The People I: Foundations, Cambridge (Mass.) 1991; ders., Constitutional Politics/Constitutional Law, 99 Yale Law Journal 453 (1989); ders., The Storrs Lectures (oben Anm. 5). Harsche Kritik übte kürzlich Laurence H. Tribe, Taking Text and Structure Seriously: Reflections on Free-Form Method in Constitutional Interpretation, 108 Harvard Law Review 1221 (1995).
15. John Hart Ely, Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review, Cambridge (Mass.) 1980. Als weiteren Vertreter können wir Jesse H. Choper, Judicial Review and the National Political Process, Chicago 1980, ins Feld führen. Beide Abhandlungen, vor allem aber Elys Buch, haben eine Flut von Veröffentlichungen ausgelöst. Der Platz reicht nicht aus, um auch nur einen repräsentativen Überblick zu geben. Daher seien lediglich mehr oder weniger zufällig die folgenden genannt: Symposium: Judicial Review versus Democracy, 42 Ohio State Law Journal 1 (1981); Symposium: Constitutional Adjudication and Democratic Theory, 56 New York University Law Review 259 (1981); Symposium on Democracy and Distrust: Ten Years Later, 77 Virginia Law Review 631 (1991); Bruce A. Ackerman, Beyond Carolene Products, 98 Harvard Law Review 713 (1985); Laurence H. Tribe, The Puzzling Persistence of Process-Based Constitutional Theories, 89 Yale Law Journal 1063 (1980); Mark V. Tushnet, Darkness on the Edge of Town: The Contributions of John Hart Ely to Constitutional Theory, 89 Yale Law Journal 1057 (1980); J.M. Balkin, The Footnote, 83 Northwestern University Law Review 275 (1989). Das Wort vom "Wachhund der Demokratie" (watchdog of democracy) verdanke ich Stephen Holmes, Precommitment and the Paradox of Democracy, in: Jon Elster/ Rune Slagstad (Hrsg.), Constitutionalism and Democracy, Cambridge (Engl.) 1988, S. 195 (197).
16. Ausf¸hrlicher (und abwägend-kritisch) Brugger, Grundrechte und Verfassungsgerichtsbarkeit in den USA (oben Anm. 8), S. 363 ff.
17. Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge (Mass.) 1978 (dt. als Bürgerrechte ernst genommen, Frankfurt/M. 1984); ders., A Matter of Principle, Cambridge (Mass.) 1985; ders., Law's Empire, Cambridge (Mass.) 1986; ders., Equality, Democracy, and the Constitution: We the People in Court, 28 Alberta Law Review 324 (1990) (eine eher schlechte Übersetzung findet sich nun in Ulrich K. Preuß [Hrsg.], Zum Begriff der Verfassung: Die Ordnung des Politischen, Frankfurt/M. 1994, S. 171); ders., What Is Equality? Part 4: Political Equality, 22 University of San Francisco Law Review 3 (1987).
18. Dazu auch noch unten sub IV.
19. Es wird deutlich, daþ ich einen eher formellen Begriff von Verantwortlichkeit zugrunde lege, der nicht mit materiellen Konzeptionen von Verantwortung zu verwechseln ist. Letzterer informiert die philosophische Ethikdiskussion etwa in den Werken von Hans Jonas, Karl-Otto Apel und Vittorio Hösle. Zur Bedeutung dieser Diskussion f¸r das Recht vgl. etwa Bodo Wiegand, Das Prinzip Verantwortung und die Präambel des Grundgesetzes, Jahrbuch des öffentlichen Rechts, N.F. Bd. 43 (1995), S. 31.
20. Zugleich aber ein caveat: Verfassungsrichter sind auch nicht ganz demokratisch-personeller Legitimation entkleidet. Sie werden von einem Wahlmännerausschuþ des Bundestages oder vom Bundesrat gewählt. Lassen wir uns auf die manchmal recht ungl¸ckliche Metapher der ÑLegitimationsketteì ein (zur Kritik vgl. etwa Brun-Otto Bryde, Die bundesrepublikanische Volksdemokratie als Irrweg der Demokratietheorie, Staatswissenschaften und Staatspraxis 1994, 305; Ulrich R. Haltern/ Franz C. Mayer/ Christoph R. Möllers, Wesentlichkeitstheorie und Gerichtsbarkeit: Zur institutionellen Kritik des Gesetzesvorbehalts, Die Verwaltung 1997, im Druck), so ist zuzugestehen, daß das Bundesverfassungsgericht durchaus durch eine solche mit dem Demos verbunden ist. Der Trend in den USA geht noch viel weiter. Sogar abgesehen von der Besetzung des Supreme Court werden in vielen Bundesstaaten die Richter gewählt, was unlängst einen Autoren dazu veranlaßt hat, Alexander Bickels Problemformulierung umzukehren und von der "majoritarian difficulty" zu sprechen. Steven P. Croley, The Majoritarian Difficulty: Elective Judiciaries and the Rule of Law (oben Anm. 9).
21. Es besteht, wie bereits angedeutet und nicht etwa nur im Hinblick auf den Diskurs des unbefleckten Rechts, die Tendenz in der deutschen Rechtswissenschaft, diese Spannung unterbelichtet zu lassen und Verfassungsgerichtsbarkeit von vornherein als dem Demokratieprinzip immanent zu behandeln. Vgl. etwa Hans-Peter Schneider, Eigenart und Funktionen der Grundrechte im demokratischen Verfassungsstaat, in: Joachim Perels (Hrsg.), Grundrechte als Fundament der Demokratie, Frankfurt/M. 1979, S. 11-49; Ernst-Wolfgang Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Vol. 1. Dies trägt m.E. nicht zur Klärung der demokratietheoretischen Probleme bei, sondern verwischt Grenzen. Vgl. demgegenüber Josef Isensee, Grundrechte und Demokratie: Die polare Legitimation im grundgesetzlichen Gemeinwesen, Der Staat 20 (1981), 161. Ebenso wird nun die amerikanische Debatte, die in dieser Beziehung viel klarer ist als die deutsche, in Anfängen rezipiert: Preuß (Hrsg.), Zum Begriff der Verfassung (oben Anm. 17).
22. James G. March/Johan P. Olsen, Democratic Governance, New York 1995.
23. Hier sei die Bemerkung gestattet, daþ das Englische eine reichere Vielfalt an semantischen Variationen f¸r den in Frage stehenden Sachverhalt bereithält und insofern auch die Definitionsgenauigkeit erhöht ist. Man nehme nur die Trias justification, responsibility, und accountability, für die das Deutsche jeweils ãVerantwortlichkeit" ins Feld zu führen sich beschränkt.
24. Vgl. insbesondere P.E. Tetlock, The Impact of Accountability on Judgment and Choice: Toward a Social Contingency Model, 25 Advances in Experimental Social Psychology 331 (1992).
25. March/Olsen, Democratic Governance (oben Anm. 22), S. 144.
29. Weiterf¸hrend - aus systemtheoretischer Sicht - Niklas Luhmann, bereits in Legitimation durch Verfahren, Frankfurt/M. 1989 (erste Aufl. 1969), insbes. S. 55 ff.; ders., Die Stellung der Gerichte im Rechtssystem, Rechtstheorie 21 (1990), 459-473; ders., Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt/M. 1993, insbes. S. 297 ff. und 407 ff. Dort auch zur Funktion der Verwaltung, die primär dem politischen, nicht dem Rechtssystem zugeordnet wird: "Auch das, was aus juristischer Sicht als Gesetzesanwendung erscheint, wird von der politischen Verwaltung eher als zielorientiertes, problemlösendes Verhalten praktiziert... Angesichts solcher Sachverhalte wäre es offensichtlich verfehlt, das Wesentliche politischer Verwaltung in der Anwendung von Gesetzen zu sehen. Wir befinden uns nicht mehr in der Situation der Frühmoderne, in der es als Lokalverwaltung kaum etwas anderes gab als Gerichte... Die staatliche Regierung und Verwaltung ist jedoch von oben bis unten eine Organisation des politischen Systems. Sie realisiert Politik und nicht Recht - wenngleich unter dem Vorbehalt, daß jederzeit die Frage aufgeworfen werden kann, ob dies rechtmäßig oder unrechtmäßig geschieht." (Das Recht der Gesellschaft, S. 429 ff.).
30. Neben March/Olsen, Democratic Governance (oben Anm. 22), S. 151 f., vgl. auch Erwin Chemerinsky, The Supreme Court 1988 Term - Foreword: The Vanishing Constitution, 103 Harvard Law Review 43 (1989).
31. March/Olsen, Democratic Governance (oben Anm. 22), S. 152.
33. Vgl. etwa Robert A. Dahl, A Preface to Economic Democracy, Oxford 1985; ders., Democracy and Its Critics, New Haven 1989.
34. Besonders klar und verdienstvoll in diesem Zusammenhang sind m.E. systemtheoretische Aufarbeitungen -- vgl. nur Niklas Luhmann, Metamorphosen des Staates, in: ders., Gesellschaftsstruktur und Semantik, Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Bd. 4, Frankfurt/M. 1995, S. 101-139; ders., Die Ausdifferenzierung des Rechts, Frankfurt/M. 1981; ders., Das Recht der Gesellschaft (oben Anm. 29); ders., Soziologische Aufklärung 4, Opladen 1987.
35. March/Olsen, Democratic Governance (oben Anm. 22), S. 153.
37. Ich halte derartige Forderungen, die auch z.T. in kommunitaristischen Abhandlungen erhoben werden (vgl. etwa Barbers ÑStrong Democratic Program for the Revitalization of Citizenshipì: Benjamin R. Barber, Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age, Berkeley et al. 1984, S. 267 ff., mit Agenda auf S. 307) f¸r ungeeignet, die Probleme des Liberalismus zu lösen. Fr¸he Kritik an solcherart Despotismus ¸bte bereits 1974 Ernst-Wolfgang Böckenförde unter dem Stichwort der ãdemokratisch-funktionalen Grundrechtstheorie" (Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation, in: Ernst-Wolfgang Böckenförde, Staat, Verfassung, Demokratie [oben Anm. 4], S. 115 ff. [133 ff.]). Für die zeitgenössische Diskussion am anschlußfähigsten halte ich Jack Balkins Progressivismuskritik (gerichtet v.a. gegen Cass R. Sunstein, Democracy and the Problem of Free Speech, New York et al. 1993), die aber gleichzeitig übersteigerte Populismusformen (etwa Richard D. Parker, 'Here, the People Rule': A Constitutional Populist Manifesto, Cambridge [Mass.]/London 1994) in den Blick nimmt: Jack Balkin, Populism and Progressivism as Constitutional Categories, 104 Yale Law Journal 1935 (1995). Vgl. dazu Ulrich R. Haltern, High Time for a Check-Up: Progressivism, Populism, and Constitutional Review in Germany, Harvard Jean Monnet Working Paper 5/96. S. auch unten sub IV.
38. Hingewiesen sei aber darauf, daþ auch Weber zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik unterscheidet, wobei letztere gerade die Verantwortlichkeit für den Erfolg des Handelns umfaßt. Hierzu sowie zu Webers Begriff der Verantwortungspolitik vgl. Winfried Brugger, Menschenrechtsethos und Verantwortungspolitik - Max Webers Beitrag zur Analyse und Begründung der Menschenrechte, Freiburg/München 1980, insbes. S. 187 ff.
39. March/Olsen, Democratic Governance (oben Anm. 22), S. 155 (meine Hervorhebungen).
40. Helmut Willke, Ironie des Staates: Grundlinien einer Staatstheorie polyzentrischer Gesellschaft, Frankfurt/M. 1992.
41. Anthony Giddens, The Consequences of Modernity, Stanford (Cal.) 1992, S. 53, 153.
42. Ich darf in diesem Zusammenhang abermals auf Stanley Fish aufmerksam machen; vgl. etwa dessen Doing What Comes Naturally: Change, Rhetoric, and the Practice of Theory in Literary and Legal Studies, Durham/ London 1989, oder Thereís No Such Thing As Free Speech, and Itís a Good Thing Too, New York/ Oxford 1994.
43. Vgl. etwa die interessanten und schillernden Beiträge in Hans Ulrich Gumbrecht/K. Ludwig Pfeiffer (Hrsg.), Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche: Situationen offener Epistemologie, Frankfurt/M. 1991.
44. March/Olsen, Democratic Governance (oben Anm. 22), S. 146. Dies ist, nebenbei gesagt, keine Einbahnstraþe.
45. Ibid., S. 161: ÑAssertions of accountability are a kind of mythology that allows acknowledgment of the faith, roughly equivalent to parental tales about Santa Claus.ì
46. Vgl. etwa William H. Riker, Liberalism Against Populism: A Confrontation Between the Theory of Democracy and the Theory of Social Choice, Prospect Heights (Ill.) 1982. Eine gute Verteidigungsschrift ist etwa Richard H. Pildes/Elizabeth S. Anderson, Slinging Arrows at Democracy: Social Choice Theory, Value Pluralism, and Democratic Politics, 90 Columbia Law Review 2121 (1990). In Deutschland hat Arrows Theorem im rechtswissenschaftlichen Bereich kaum für Unruhe gesorgt. In den Vereinigten Staaten hingegen findet sich kaum noch eine größere Abhandlung des Verfassungsrechts und der Verfassungstheorie, die nicht nachdenklich die Ergebnisse der social choice-Theorie kommentiert, zum Teil ablehnend, zum Teil besorgt: etwa Laurence Tribe, American Constitutional Law, 2nd ed. 1988, § 1-8, S. 12 Anm. 6; Cass Sunstein, The Partial Constitution, Cambridge (Mass.) 1993, S. 125 und 163; Bruce Ackerman, Social Justice in the Liberal State, New Haven 1980, S. 293.
47. Vgl. hierzu ausf¸hrlicher Ulrich R. Haltern, Integration als Mythos -- Zur Ðberforderung des Bundesverfassungsgerichts, in Jahrbuch des öffentlichen Rechts (im Druck).
50. Die Auseinandersetzung mit Subjekt und Subjektivität -- dies bedarf kaum der Erwähnung -- ist ein besonderes thematisches Anliegen postmoderner Bewegungen. In bezug auf den Formalismus von Christopher Langdell etwa hat sich die amerikanische postmoderne Rechtstheorie, insbesondere einer ihrer wichtigsten Vertreter, Pierre Schlag, mit der Entfernung des Subjekts aus dem Rechtsdiskurs beschäftigt. Der Langdellsche Formalismus liegt dem deutschen formalistischen Rechtsdiskurs in vielen Punkten sehr nahe, und es ist interessant, Parallelen zu ziehen. Nicht nur wird das Recht in beiden Diskursen zu einem transzendenten Objekt -- vielmehr gehen beide so weit, es als transzendentes Subjekt auftreten zu lassen, indem sie das Recht eigenständig etwas determinieren, entscheiden, tun lassen. Siehe Pierre Schlag, The Problem of the Subject, 69 Texas Law Review 1627 (1991); ders., Normativity and the Politics of Form, 139 University of Pennsylvania Law Review 801 (1991); ders., 'Le Hors de Texte, C'est Moi': The Politics of Form and the Domestication of Deconstruction, 11 Cardozo Law Review 1631 (1990); vgl. ebenso J.M. Balkin, Understanding Legal Understanding: The Legal Subject and the Problem of Legal Coherence, 103 Yale Law Journal 105 (1993); Gary Minda, Postmodern Legal Movements: Law and Jurisprudence at Century's End, New York 1995, S. 14 ff.
51. Der geneigte Leser wird lächelnd die ironische Selbstreferenz dieser Bemerkung quittieren, da sich auch der vorliegende Beitrag [sic!] streng an diese Regeln hält.
52. Das Wort von der ìpermanenten Gegenwartî verdanke ich -- in anderem Zusammenhang -- Eric Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts (aus dem Englischen von Yvonne Badal), M¸nchen/ Wien 1995, S. 17.
53. Vgl. etwa Niklas Luhmann, The Morality of Risk and the Risk of Morality, 3 International Review of Sociology 87 (1987); ders., The Code of the Moral, 14 Cardozo Law Review 995 (1993); ders., Paradigm Lost: Ðber die ethische Reflexion der Moral (Rede anläþlich der Verleihung des Hegel-Preises 1989), Frankfurt/M. 1990, S. 7 ff.; ders., Ethik als Reflexionstheorie der Moral, in: ders., Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft Bd. 3, Frankfurt/M. 1993, S. 358-447; ders., Soziologie der Moral, in: ders./Stephan H. Pfürtner (Hrsg.), Theorietechnik und Moral, Frankfurt/M. 1978, S. 8-116; ders., Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt/M. 1984, S. 317 ff.
54. March/Olsen, Democratic Governance (oben Anm. 22), S. 178.
55. Eunuchen genieþen deshalb besonderes Ansehen in einem Harem, weil sie keine Gefahr f¸r die sexuelle Ordnung darstellen. Ihr spezifischer Wert resultiert insoweit aus ihrer Irrelevanz, die dann gefährdet ist, wenn ein Eunuch eine eigenständige Position in der sexuellen Ordnung zu erringen trachtet. Daher, so die Argumentation, ist jedes Streben nach sexueller Signifikanz von vornherein zum Scheitern verurteilt: wahrscheinlich kann eine solche Signifikanz gar nicht erst erreicht werden. Sollte dies aber doch geschehen, dann wird genau diese Signifikanz den sozialen Nutzen des Eunuchen schmälern. March und Olsen halten nicht nur Gerichte, sondern ebenso etwa Universitäten und das Beamtentum für "Eunuchen-Institutionen der Demokratie": id., S. 100 ff. Ähnlich läßt sich der Argumentationsansatz des kürzlich erschienenen Buches von Sunstein interpretieren. Im Gegensatz etwa zu Rawls' "overlapping consensus", der von der Möglichkeit eines sich auf allgemeine grundlegende Prinzipien erstreckenden Konsenses ausgeht (John Rawls, Political Liberalism, New York 1993, insbes. S. 133 ff.), sieht Sunstein den Erfolg und die Zukunft des Rechts gerade darin, daß es abstrakte Grundprinzipien meidet und sich stattdessen auf sog. "incompletely theorized agreements" beschränkt. Cass R. Sunstein, Legal Reasoning and Political Conflict, New York/Oxford 1996.
56. J¸rgen Habermas, Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt/M. 1992, etwa S. 323 f.
57. Unbestritten ist hingegen, daß das Bewußtsein überlegener Rationalität des professionellen juristischen Diskurses zum Selbstbewußtsein nicht nur des Bundesverfassungsgerichts selbst, sondern insbesondere auch der Staatsrechtslehre mit ihrer (euphemistisch:) kritischen Distanz zur Politik beiträgt.
58. Walter Metzger, Academic Freedom in the Age of the University, New York 1961, S. 91 f. Anthony Kronman hält -- auf die USA bezogen -- Professoren f¸r der Wahrheit in gröþerem Maþe verschrieben als Anwälte (Anthony T. Kronman, Foreword: Legal Scholarship and Moral Education, 90 Yale Law Journal 955 [1981]; ders., The Lost Lawyer: Failing Ideals of the Legal Profession, Cambridge [Mass.] 1993) -- eine Ansicht, die ich im Hinblick auf den deutschen Rechtsdiskurs nicht teile. Vgl. auch Sanford Levinson, Constitutional Faith, Princeton 1988, insbes. Kapitel 5 ("The Law School, the Faith Community, and the Professing of Law").
59. Diese Bezeichnung wähle ich in Anlehnung an das Englische. Im Deutschen ist der Begriff pejorativ belegt, doch ich appelliere an den Leser, diese Belegung so weit wie irgend möglich zu vergessen. "Populismus" als politische Kategorie (im nicht-pejorativen Sinne) findet auch zunehmend Eingang in die deutsche sozialwissenschaftliche Diskussion: vgl. Helmut Dubiel, Das Gespenst des Populismus, in: ders., Ungewißheit und Politik, Frankfurt/M. 1994, S. 186.
60. Balkin, Populism and Progressivism (Anm. 37), S. 1947. An dieser Stelle sei noch angemerkt, daþ das Verhältnis von Expertise und politischem System keineswegs statisch ist. Die Dynamik ist allerdings eine eher negative. Experten (und Expertise) werden Teil des politischen Systems. Zum einen werden sie dazu benutzt, politische Ansichten mit mehr Legitimation zu versehen; zum anderen wird sowohl den Akteuren (Experten) als auch ihrer Botschaft (Wissen) nunmehr mißtraut, da sie ja nun eine strategisch-politische Rolle spielen. Auch die Experten selbst empfinden sich nun weniger als Teil des Wissenschaftssystems (systemtheoretisch: mit dem Code wahr/ unwahr, also auf der Suche nach der Wahrheit), sondern als Teil des politischen Systems (das nicht unter diesem Code operiert), da sie ja nun "Einfluß haben". Expertise als solche wird hierdurch als Institution unterminiert. Es handelt sich wohl um einen Fall von verlorener Unschuld. Vgl. hierzu auch James G. March/ Johan P. Olsen, Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics, New York 1989, S. 30 ff.
61. Dies bedeutet nat¸rlich nicht, daþ es sich um ein unzutreffendes Argument handelt. Eine umfassende, neuere Formulierung findet sich bei Robert A. Dahl, A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen Participation, 109 Political Science Quarterly 23 (1994).
62. Anders allerdings-- mit Hilfe der Unterscheidung zwischen ìradikalemî und ìgeläutertemî Pluralismus -- Winfried Brugger, Radikaler und geläuterter Pluralismus, Der Staat 29 (1990), 497.
63. Karl Dietrich Bracher, Die Auflösung der ersten deutschen Demokratie, in: ders., Wendezeiten der Geschichte: Historisch-politische Essays, München 1995, S. 121 (121).
64. In diesem Sinne k¸rzlich etwa Richard Häuþler, Der Konflikt zwischen Bundesverfassungsgericht und politischer F¸hrung. Ein Beitrag zu Geschichte und Rechtsstellung des Bundesverfassungsgerichts, Berlin 1994.
65. Paul W. Kahn, Legitimacy and History: Self-Government in American Constitutional Theory, New Haven/ London 1992, etwa S. 223: ìTheorie wird sich notwendigerweise ¸ber die Praxis hinaus bewegen, aber niemand lebt vollständig in der Theorie. Sogar Sokrates muþte die Taten der Autorität erleiden. Alle diejenigen, die einen Ausgleich anstreben zwischen Diskurs und Autorität, sollten die sokratischen Risiken anerkennen, die mit wirklichem Diskurs einhergehen."