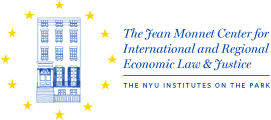
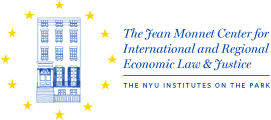 |
©Copyright: Joseph H.H. Weiler , 1995.
I. Einleitung
II. Europa: Die
Kein-Demos-These
III. Das europäische
Demokratiedefizit und die Kein-Demos-These
IV. Die
Kein-Demos-These: Welches Gemeinwesen? Welche Zugehörigkeit?
V. Supranationalität: Gemeinschaft, Nation und Staat
VI. Zwischen Staats-Bürgerschaft und
Unions-Zugehörigkeit
Selbst mit nur geringem zeitlichen Abstand fällt es bereits schwer, sich das Drama der langwierigen, unerwarteten, quälenden und dennoch willkommenen nationalen Debatten und Ratifikationsprozesse um den Vertrag von Maastricht ins Gedächtnis zurückzurufen. Das praktische Ergebnis - die Annahme durch alle zwölf Mitgliedstaaten - erscheint nun als ein unspektakuläres, 'in der Rückschau vorhersehbares' historisches Faktum. Von fortdauerndem Interesse sind jedoch die Lehren, die hinsichtlich politischer Prozesse, sozialer Sensibilitäten und institutioneller sowie öffentlicher Standpunkte in den verschiedenen Mitgliedstaaten aus der Ratifikations-Saga gezogen werden können.
Deutschland ist in dieser Hinsicht von besonderem Interesse, da hier das letzte Wort in der nationalen Debatte das Bundesverfassungsgericht hatte, das eine besonnene, abwägende und doch deutliche Stimme besitzt, im Gegensatz etwa zum eher rüpelhaften Stil des britischen Unterhauses oder der Leidenschaft, die den Kampf um Wählerstimmen bei den Referenden in Frankreich und Dänemark auszeichnete. Die Maastricht-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts [1] hat natürlich eine Vielzahl von Stellungnahmen hervorgerufen. [2] Die Entscheidung selbst ist inzwischen so bekannt, daß auf eine Zusammenfassung verzichtet werden kann. Trotz der formalen Bestätigung des Vertrags, die den Weg für die deutsche Ratifikation und damit auch für das Inkrafttreten von Maastricht ebnete, wird die Entscheidung vor allem wegen der pointierten und zum Teil provokanten Positionen diskutiert, die das Bundesverfassungsgericht hinsichtlich einiger der vom Europäischen Gerichtshof herausgearbeiteten ehernen Verfassungsgebote und -grundsätze der Gemeinschaft einnimmt, wie etwa hinsichtlich der "gerichtlichen Kompetenz-Kompetenz" (d.h. der Frage, welchem Gericht die Letztscheidungsgewalt über die Grenzen der Gemeinschaftskompetenzen zukommt) [3], des Austritts aus der Gemeinschaft und der Union [4] und ähnlichem. Natürlich fehlt es nicht an kritischen Kommentaren zu diesen und anderen Punkten, meistenteils aus der Feder deutscher Verfassungsrechtler. [5]
Ich möchte dieser fortdauernden kritischen Reflexion die Perspektive eines 'Außenseiters' hinzufügen. Mich interessieren dabei nicht spezifische verfassungsrechtliche Probleme. Vielmehr werde ich mich der verfassungsrechtlichen Weltanschauung des Bundesverfassungsgerichts zuwenden, wie sie in dieser Entscheidung zum Ausdruck kommt. Die Entscheidung eines Gerichts dieses Ranges bezüglich einer Fragestellung von so großer Bedeutung ist immer mehr als eine einfache dogmatische Herausarbeitung positiven Rechts und seine Anwendung auf einen bestimmten Sachverhalt. Sie beinhaltet zwangsläufig die Entwicklung tiefergehender Prinzipien und enthüllt gleichzeitig das Verfassungsethos und -verständnis des Gerichts und seiner Richter. [6] Die Frage, in welchem Ausmaße die Entscheidung darüber hinaus weitverbreitete gesellschaftliche Einstellungen in Deutschland widerspiegelt, kann nicht präzise beantwortet werden.
In seiner kritischen Haltung gegenüber der Zukunft des europäischen Hauses vermeidet das Bundesverfassungsgericht die krasse Sprache des Nationalismus und das Vokabular eines unverhohlenen Chauvinismus, die weite Teile der politischen Opposition zu Maastricht gekennzeichnet haben. Stattdessen präsentiert es seine Position als notwendig zur Erfüllung seines Verfassungsauftrages, der darin besteht, die Unterminierung der demokratischen Natur des politischen Prozesses, wie ihn das Grundgesetz garantiert, zu verhindern. Damit präsentiert sich das Bundesverfassungsgericht als Garant universeller demokratischer Werte, und nicht als Garant eines deutschen Partikularismus.
Meine Kritik richtet sich auf diesen Aspekt der Entscheidung und bezieht sich auf die explizite und implizite Beurteilung des gegenwärtigen Standes der europäischen Integration sowie ihrer zukünftigen Entwicklung durch das Gericht. Um nichts zu beschönigen: aus Gründen, die ich noch darlegen werde, betrachte ich die Entscheidung, soweit sie die bestehende Gemeinschaft betrifft, als peinlich; soweit sie ihre ihre zukünftige Entwicklung betrifft, finde ich sie traurig, ja sogar beklagenswert.
Sie ist peinlich, da das Bundesverfassungsgericht, während es sich selbst als Garant zukünftiger Demokratie darstellt, aus politischen und anderen Gründen [7] gezwungen ist, die Gemeinschaft und Union von heute zu akzeptieren und 'reinzuwaschen', obwohl diese ganz offensichtlich an schwerwiegenden demokratischen Defiziten leidet - was aus meiner Sicht allgemein anerkannt ist. Um dieses Kunststück zu bewerkstelligen, muß das Gericht eine Position beziehen, die impliziert, daß die existierenden Demokratiedefizite der Gemeinschaft durch die politischen Strukturen und Prozesse der Mitgliedstaaten ausgeglichen werden. [8] Diese Position jedoch macht das Ganze nur noch peinlicher. Auf der einen Seite nämlich leugnet sie in gewissem Umfang die dringende Notwendigkeit einer substantiellen Demokratisierung der gegenwärtigen Entscheidungsprozesse der Gemeinschaft/Union, sowohl auf europäischer als auch mitgliedstaatlicher Ebene - ein Anliegen, das in den letzten Jahren von der deutschen Bundesregierung lobenswerterweise durchweg unterstützt wurde. Wenn ein Verfassungsgericht mit einem derartigen Prestige, ein Gericht, das ausdrücklich den Maßstab der Demokratie anlegt, der gegenwärtigen Gemeinschaft (trotz ein wenig kritischer Rhetorik) ein Gesundheitsattest ausstellt, warum sollte man dann an ihren grundlegenden institutionellen Strukturen und Entscheidungsprozessen herumbasteln? Auf der anderen Seite: sollte das Bundesverfassungsgericht tatsächlich glauben, daß die politischen Strukturen und Prozesse in den Mitgliedstaaten das Demokratiedefizit der Gemeinschaft ausgeglichen haben, dann muß dies unser Vertrauen in sein eigenes Demokratieverständnis und in seine Fähigkeit und Bereitschaft erschüttern, effektive Garantien für die Zukunft zu geben.
Es ist eine traurige, ja sogar beklagenswerte Entscheidung vor allem aber aus gewichtigeren Gründen.
Demokratie existiert nicht in einem Vakuum. Sie setzt ein Gemeinwesen mit Mitgliedern - dem Demos - voraus, durch die und für die der demokratische Diskurs mit seinen vielen Varianten stattfindet. Die Autorität und Legitimität einer Mehrheit, sich gegenüber der Minderheit durchzusetzen, existiert nur innerhalb politischer Grenzen, die durch den Demos definiert werden. Selbst wenn daher die semantische Oberfläche der Entscheidung Demokratie zum Thema hat, so offenbart doch ihre tiefere Struktur das explizite und implizite, bewußte und unterbewußte Verständnis des Verfassungsgerichts und seiner Richter von der wahren Natur des Gemeinwesens und den Kriterien der Zugehörigkeit zu ihm. Da das Grundgesetz selbst, ebenso wie viele andere Verfassungen, keine umfassende Antwort auf diese Fragen gibt, mußte das Gericht auf tieferliegende Schichten jenseits des ausdrücklichen Verfassungstextes zurückgreifen. Diese Schichten werden, meistens unausgesprochen, einfach vorausgesetzt. Sie erscheinen, wie manchmal Sprache überhaupt, so 'natürlich' und 'neutral', daß dies die relativ sparsame Aufmerksamkeit erklärt, die ihnen in den umfangreichen deutschen Kommentaren zu dieser Entscheidung gewidmet wird. [9] Diese Fragen nach der Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit, nach Mitgliedschaft und Macht, nach Demos und Ethnos, haben die gewaltsame Geschichte Europas in diesem Jahrhundert begleitet und seit Ende des Zweiten Weltkrieg einen guten Teil der politischen Debatte geprägt. Seit dem Fall der Berliner Mauer sind sie erneut in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt, mit dem Wiedererscheinen des häßlichen Gesichts von nationalen und ethnischen Konflikten und ethnischen Säuberungen in den alten-neuen Staaten Osteuropas und der früheren Sowjetunion und mit dem beunruhigenden Anstieg von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus sogar in Westeuropa. Angesichts dessen besteht ein Bedarf für geistige und moralische Führung in diesen Fragen, die Politiker, ständig bedacht auf ihre Klientel, nicht immer leisten können. Wir dürfen daher erwarten, daß unsere Gerichte - ohne dabei die Sphäre des Juristischen zu verlassen - einen Teil dieser Führung bilden. Die Europäische Gemeinschaft/Union kann keine Zauberrezeptur für diese Krankheiten anbieten, aber sie ermöglicht es uns wenigstens, die Konzepte 'Gemeinwesen' und 'Zugehörigkeit' - das Konzept 'Demos' - in kreativer Weise zu überdenken - ein Überdenken, welches das Wertvolle des klassischen europäischen Nationalstaates bewahren mag, ihn aber gleichzeitig vor seinen Exzessen schützt.
Wie betrüblich ist es dann, das Bundesverfassungsgericht zu beobachten, wie es angesichts der Notwendigkeit und historischen Chance, diese Fragen im Kontext von Gemeinschaft und Mitgliedstaat zu überdenken, wie Lots Frau seinen Blick zurückwirft auf ein Gemeinwesen, gegründet auf die müden, alten Vorstellungen eines ethno-kulturell homogenen Volkes und der unheiligen Dreieinigkeit von Volk-Staat-Staatsangehöriger als der ausschließlichen Basis für demokratische Autorität und legitime Normsetzung. Möglicherweise scheint eine subtile Spur Scham oder zumindest Unbehagen in der Argumentation des Verfassungsgerichts durch, die nach Legitimierung verlangt. Warum sonst hätte das Gericht Hermann Heller, den Sozialisten, Antifaschisten, Juden und Carl Schmitt-Kritiker, als einzigen Beleg für die Behauptung von der Erforderlichkeit einer Homogenität des Volkes gewählt? Läßt das nicht eine gewisse Besorgnis vermuten, ein koscheres Siegel der Zustimmung zu finden für diese wenn auch blutarme und rassisch neutrale Version des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts dessen, was in alten Zeiten den Slogan von Blut (Volk) und Boden (Staat) nährte? [10]
Angesichts der großen Herausforderungen, denen sich Deutschland im Hinblick auf die Frage der 'Gastarbeiter', des eigenen Brandherdes wachsender Xenophobie und erneuten Antisemitismus und ähnlichem sowie seiner neuen Position als internationale Führungsmacht gegenübersieht, ist es traurig für den deutschen Verfassungsstaat [11], wenn das Bundesverfassungsgericht unter all den reichhaltigen Strömungen in der gegenwärtigen deutschen Debatte um Gemeinwesen und Zugehörigkeit gerade diese eine herausgreifen mußte.
Die Entscheidung ist beklagenswert, soweit das Gericht versucht, diese problematischen Konzeptualisierungen auf die Gemeinschaft/Union selbst zu projizieren, ja ihr aufzuzwingen, und damit nicht nur die Möglichkeit einer Demokratisierung auf europäischer Ebene zu untergraben, sondern, wie sich zeigen wird, sie sogar auszuschließen und implizit der Gemeinschaft ein Ziel unterzuschieben, das den Gründungszwecken der europäischen Integration fremd ist.
Im folgenden werde ich versuchen, sowohl die Natur meiner Kritik detaillierter darzulegen als auch Alternativen im Hinblick auf das Verständnis der Gemeinschaft/Union und ihrer Mitgliedstaaten aufzuzeigen.
Die besondere Aufmerksamkeit des Bundesverfassungsgerichts gilt der Gefahr, die der voranschreitende Prozeß der europäischen Integration und insbesondere das dem Maastrichter Vertrag inhärente Potential für den demokratischen Charakter des Gemeinwesens darstellen. In diesem Zusammenhang mußte das Gericht das Demokratisierungspotential der Europäischen Union auf der europäischen Ebene ansprechen. Seine Haltung ist skeptisch. [12] Es ist nicht diese Skepsis an sich, die interessant oder beunruhigend ist. Man kann und soll sogar hinsichtlich der Demokratie innerhalb der Europäischen Union beunruhigt sein, und da keine einfache Lösung in Sicht ist [13], sind Skepsis hinsichtlich des Istzustandes und vorsichtiges Abwägen im Hinblick auf die Zukunft sogar lobenswert. Interessant und meiner Ansicht nach ziemlich besorgniserregend ist allerdings das Fundament, auf dem die Skepsis des Bundesverfassungsgerichts ruht. Diese wird genährt von der, wie wir es nennen werden, 'Kein-Demos-These'. Diese scheinbar elegante These beruht auf einer starken Strömung - wie dominant sie ist, ist schwer zu sagen - innerhalb der deutschen Staatsrechtslehre, die unter anderem in den Arbeiten Paul Kirchhofs, der als Architekt der Maastricht-Entscheidung gilt [14], vertreten ist und von zahlreichen anderen geteilt wird [15]. Aus Fairneß gegenüber den übrigen Richtern des Gerichts ist einzuräumen, daß die Sprache der Entscheidung nicht in allen Bereichen die 'hard core'-Version von Kirchhof wiedergibt. Vergleicht man die Arbeiten Kirchhofs und die Entscheidung, so erhält man den Eindruck eines Gerichts, das nicht in jeder Hinsicht glücklich mit den vollblütigen Ansichten seines Berichterstatters war, das aber auch keine alternative Konstruktion präsentieren konnte. Der Kompromiß scheint eine verwässerte Version von Kirchhof zu sein. Die gewogenste Interpretation ist, daß es zwei mögliche Lesarten der Entscheidung gibt. Falls dies der Fall sein sollte (was ich bezweifle), dann nehme der Leser diesen Beitrag als normative Anregung, die Kirchhofsche Version des Urteils abzulehnen.
Die geistigen Wurzeln der Kein-Demos-These reichen natürlich weit über Kirchhof hinaus. Die Kein-Demos-These findet ihren Ausdruck auch im positiven deutschen Recht, insbesondere im Staatsangehörigkeitsrecht, das die Bedingungen der Zugehörigkeit zum deutschen Gemeinwesen regelt. Die Entscheidung bedeutet nun eine Übertragung des Verständnisses des Gerichts vom deutschen Gemeinwesen auf die europäische Ebene.
Im Folgenden werde ich eine zusammenfassende Version der Kein-Demos-These vorstellen, die aus der Entscheidung des Gerichts selbst sowie den Arbeiten einiger der wichtigsten Vertreter dieser These abgeleitet ist. Ich zeige in dieser Version darüber hinaus auf, was ich für einige der Implikationen halte, die logisch aus der These folgen oder implizit in ihr enthalten sind, auch wenn die Autoren selbst sich davor scheuen, sie darzulegen.
Die Angehörigen eines Gemeinwesens, das Volk, sein Demos, ist ein Konzept, das eine subjektive - sozialpsychologische - Komponente besitzt, die in objektiven, organischen Bedingungen wurzelt. Sowohl das Subjektive als auch das Objektive kann empirisch so beobachtet werden, daß wir in der Lage sind, auf der Basis von Beobachtung und Analyse zum Beispiel festzustellen, daß es kein europäisches Volk gibt.
Die subjektiven Manifestierungen der Volkszugehörigkeit, des Demos, finden sich in einem Gefühl sozialer Kohäsion, eines gemeinsamen Schicksals und einer kollektiven Identität, die wiederum in Loyalität resultieren (und sie verdienen). [16] Diese subjektiven Manifestierungen besitzen damit sowohl ein deskriptives als auch ein normatives Element.
Die subjektiven Manifestierungen sind sowohl Resultante als auch gleichzeitig Bedingung einiger - wenn auch nicht notwendigerweise aller - der folgenden objektiven Elemente: gemeinsame Sprache [17], gemeinsame Geschichte, gemeinsame kulturelle Bräuche und Empfindungen [18] und - was nach den zwölf Jahren des Nationalsozialismus nur verhalten ausgedrückt wird - eine gemeinsame ethnische Herkunft, eine gemeinsame Religion. Diese Faktoren erfassen nicht die Essenz dessen, was das Volk ausmacht - man wird immer auch Verbindungen zu spirituellen und sogar mystischen Elementen finden. [19] Wenn auch verschiedene Autoren mit unterschiedlichen Mischungen der genannten Elemente operieren, so ist doch das Beharren auf einem mehrschichtigen Begriff von Homogenität, gemessen am Maßstab dieser organisch-kulturellen Kriterien, typischerweise ein wichtiges und in der Tat kritisches Element des Diskurses. Hier liegt natürlich der heikelste Aspekt der Theorie, da das Beharren auf Homogenität das ist, was in seiner staatlichen Operationalisierung die Regeln für Inklusion und Exklusion bestimmt. Als etwa Juden in vielen europäischen Nationalstaaten von der vollen Zugehörigkeit als gleiche Bürger ausgeschlossen wurden, geschah dies oft aufgrund der Theorie, daß das Christsein essentiell für die Homogenität des Volkes sei. [20]
Die 'organische' Natur des Volkes ist eine heikle Angelegenheit. Ich nenne 'organisch' diejenigen Teile des Diskurses, die mehr oder weniger eine oder mehrere der folgenden Behauptungen aufstellen: Das Volk geht historisch und politisch dem modernen Staat voraus. [21] Deutschland konnte sich als moderner Nationalstaat entwickeln, weil es bereits ein deutsches Volk gab. 'Nation' ist einfach eine moderne Benennung, im Kontext von modernistischer politischer Theorie und Völkerrecht, des bereits existierenden Volkes, und der Staat ist sein politischer Ausdruck. [22] Es ist dieser Blickwinkel, aus dem die Argumentation für die deutsche (Wieder)vereinigung Überzeugungskraft schöpfte. Man konnte den deutschen Staat teilen, nicht jedoch die deutsche Nation. Folglich mag man zwar von einer Vereinigung der Staaten sprechen, jedoch nur von einer Wiedervereinigung des Volkes.
Anthropologisch gesehen ist dieses Verständnis etwa des Deutschseins, d.h. Teil des deutschen Volkes zu sein, 'organisch' im folgenden Sinne: Es hat zunächst eine fast natürliche Konnotation. Man wird als Deutscher geboren, ebenso wie man als Mann oder Frau geboren wird - obwohl man seine nationale Identität etwas leichter wechseln kann (doch selbst dann wird man 'ex-Deutscher' bleiben). Und in dem Ausmaße, in dem Ethnizität in diesem Diskurs über das Volk weiterhin eine Rolle spielt - sicherlich verhalten -, ist Ethnizität sogar noch unwandelbarer als das Geschlecht: es gibt keine Operation, welche die Ethnizität verändern kann. Aus dieser Ansicht folgt, daß die Nationalität einer Person als Form der Identität fast primordial ist und dabei anderen Formen des Bewußtseins und der Zugehörigkeit vorgeht. Ich mag mich solidarisch fühlen mit anderen Christen, mit anderen Arbeitern, mit anderen Frauen. Das macht mich zu einem christlichen Deutschen, einem sozialistischen Deutschen, einer feministischen Deutschen, oder bestenfalls einem deutschen Christen, einem deutschen Sozialisten, einer deutschen Feministin. Ich kann jedoch meiner volksbezogenen, nationalen Identität nicht entkommen.
Niemand vertritt heute, daß das 'Organische' absolut sei. Man kann etwa 'naturalisiert' werden, die Zugehörigkeit zu einer anderen Nation erwerben. - aber spricht nicht selbst in diesem Zusammenhang der Begriff 'Naturalisation' Bände? Und man kann sich - mehr hypothetisch denn tatsächlich - vorstellen, daß, sollten die objektiven Bedingungen sich in ausreichendem Umfang verändern und sich ein neues Maß an Homogenität in Sprache, Kultur und gemeinsamer historischer Erfahrung entwickeln, ein entsprechendes subjektives Bewußtsein folgen könnte und ein neues Volk/eine neue Nation entstünde. Doch realistischerweise können solche Veränderungen nur in einem 'geologischen' Zeitrahmen erwartet werden, sind nur in Epochen, nicht in Generationen möglich.
Das Konzept des Volkes fügt sich sehr leicht in die moderne politische Theorie ein. Das Grundgesetz mag das Nachkriegsdeutschland begründet haben, doch es hat sicherlich nicht das deutsche Volk begründet, außer vielleicht in einem engen rechtlichen Sinne. Das Volk, die Nation, verstanden in diesem nationalen, ethno-kulturellen Sinn, bilden das Fundament des modernen Staates. [23] Sie sind die Basis im herkömmlichen Verständnis von Selbstbestimmung als der politischen Unabhängigkeit in Form eines eigenen Staates. Nur Nationen können Staaten besitzen. [24] Der Staat gehört zur Nation - seinem Volk -, und die Nation (das Volk) 'gehört' zum Staat. [25]
Volk/Nation sind auch das Fundament für den modernen demokratischen Staat: Die Nation und ihre Angehörigen, das Volk, konstituieren das Gemeinwesen zu dem Zweck, die Disziplin demokratischer, mehrheitlicher Herrschaft zu akzeptieren. Sowohl deskriptiv als auch präskriptiv (wie es ist und wie es sein soll) wird/soll eine Minderheit die Legitimität einer Mehrheitsentscheidung akzeptieren, da beide, Mehrheit und Minderheit, Teil desselben Volkes sind, der gleichen Nation angehören. Dies ist ein integraler Bestandteil dessen, was Herrschaft des Volkes - Demokratie - nach dieser Lesart meint. Damit konstituiert Nationalität den Staat (folglich National-Staat), der wiederum ihre politische Grenze bildet, ein Gedanke, der von Schmitt bis zu Kirchhof reicht. [26] Die Bedeutung der politischen Grenze erstreckt sich nicht nur auf das ursprüngliche Verständnis von politischer Unabhängigkeit und territorialer Integrität, sondern auch auf die grundlegende demokratische Natur des Gemeinwesens. Ein Parlament ist aus dieser Perspektive eine demokratische Institution nicht nur, weil es einen Mechanismus für Repräsentation und Mehrheitsentscheidung bereitstellt, sondern weil es das Volk, die Nation, den Demos repräsentiert, von dem sich die Autorität und Legitimität seiner Entscheidungen ableiten. [27] Um diesen Punkt klarzumachen stelle man sich einen Anschluß Dänemarks an Deutschland vor. Man versuche nun, den Dänen zu erzählen, sie bräuchten sich keine Sorgen zu machen, da sie im Bundestag voll repräsentiert sein werden. Ihr Wehgeschrei wäre schrill, nicht einfach weil sie als Dänen zu permanenter Minderheit verurteilt wären (das mag auf die deutschen Grünen ebenfalls zutreffen) [28], sondern weil nach der Art, wie Nationalität und mit Demokratie miteinander verstrickt sind, in diesem Gedankengang, selbst die Herrschaft der Mehrheit nur legitim ist innerhalb eines Demos, wenn Dänen Dänen regieren. [29] Somit ist Demos eine Bedingung für Demokratie. Wenn im Gegensatz dazu Demokraten wie Alfred Verdross für ein Großdeutschland [30] plädierten, war dies sicherlich nicht von einer irgendwie gearteten proto-faschistischen Vorstellung motiviert, sondern vom Glauben, daß die deutschsprachigen Völker eigentlich ein Volk seien, im Sinne dieser besonderen Vorstellung von Volkszugehörigkeit.
Wenden wir uns nun Europa zu, so wird argumentiert, daß auf der Basis dieser organischen kulturellen-nationalen Kriterien empirisch betrachtet ein europäischer Demos nicht existiert [31] - kein europäisches Volk, keine europäische Nation. [32] Es existieren weder das subjektive Element (das Bewußtsein einer gemeinsamen kollektiven Identität und Loyalität) noch die objektiven Bedingungen, die diese erzeugen könnten (die Art von Homogenität der organischen national-kulturellen Bedingungen, auf denen Volkszugehörigkeit beruht). Langfristige friedliche Beziehungen mit sich verdichtendem wirtschaftlichem und sozialem Austausch sollten nicht verwechselt werden mit dem Zusammenhalt durch Volkszugehörigkeit und Nationalität, geschmiedet durch Sprache, Geschichte, Ethnizität usw. An diesem Punkt entdecken wir zwei Versionen der Kein-Demos-These. Die abgemilderte, 'weiche' Version des Gerichts selbst [33] ist die Noch Nicht-Version [34]: Obwohl gegenwärtig kein Demos existiert, ist die Möglichkeit eines solchen für die Zukunft nicht von vornherein ausgeschlossen. Wenn und soweit sich einmal ein europäischer Demos entwickeln sollte, dann - und auch nur dann - müssen die grundlegenden politischen Prämissen der Entscheidung überdacht werden. Dies ist in der vorhersehbaren Zukunft unwahrscheinlich. [35] Die radikale, 'harte' Version lehnt diese Möglichkeit nicht nur als objektiv unrealistisch, sondern auch als nicht wünschenswert ab: es wird (meiner Ansicht nach korrekt) argumentiert, daß die europäische Integration nicht die Schaffung einer europäischen Nation oder eines europäischen Volkes zum Ziel hat, sondern eine immer engere Union zwischen den Völkern Europas. [36] Was die 'abgemilderte' und die 'radikale' Version jedoch teilen, ist ein gemeinsames Verständnis von Volkszugehörigkeit, ihrer Charakteristika und Manifestationen.
Abgemilderte oder radikale Version, die Konsequenzen der Kein-Demos-These für das Europäische Haus sind von großem Interesse. Die rigorose Auswirkung dieser Ansicht wäre, daß in Abwesenheit eines Demos per definitionem keine Demokratie oder Demokratisierung auf europäischer Ebene möglich ist. [37] Das ist keine bloß semantische Behauptung. Nach dieser Lesart unterscheidet sich europäische Demokratie (d.h. zumindest ein bindender Mehrheitsentscheidungsprozeß auf europäischer Ebene) ohne Demos in keiner Weise von dem vorher erwähnten deutsch-dänischen Anschluß, abgesehen von den Dimensionen. Den Dänen Stimmrecht im Bundestag zu geben ist, wie dargelegt, ein wirklich schwacher Trost. Ihnen Stimmrecht im europäischen Parlament oder dem Ministerrat zu geben, macht konzeptionell keinen Unterschied. Dies träfe auf jeden Nationalstaat zu. Europäische Integration mag dieser Ansicht nach zwar einen gewissen Transfer von Staatsfunktionen an die Union beinhaltet haben, der jedoch nicht begleitet worden ist von einer Neubestimmung der politischen Grenzen; eine solche kann nur vorgenommen werden, wenn man von der Existenz eines europäischen Volkes sprechen könnte. Da dies, so wird behauptet, bisher noch nicht der Fall ist, können die Union und ihre Institutionen weder die Autorität noch die Legitimität eines 'demos-kratischen' Staates besitzen. [38] Die Stärkung des europäischen Parlaments ist keine Lösung und könnte - in dem Ausmaße, in dem sie den Ministerrat (die Stimme der Mitgliedstaaten) schwächt - das Legitimitätsproblem der Gemeinschaft sogar noch verstärken. [39] Dieser Ansicht nach ist ein Parlament ohne Demos konzeptionell unmöglich und in der Praxis despotisch. Wenn das Europäische Parlament nicht der Repräsentant eines Volkes ist, wenn die territorialen Grenzen der EU nicht ihren politischen Grenzen entsprechen, dann hat die Verfügung eines solchen Parlaments nur geringfügig mehr Legitimität als die Verfügung eines Alleinherrschers.
Was aber, wenn die funktionale Kooperation mit anderen Nationalstaaten dem Interesse eines Nationalstaates dienen würde? Die Kein-Demos-These hat eine implizite, traditionelle Lösung: Kooperation durch internationale Abkommen - frei geschlossen durch die 'Hohen Vertragschließenden Parteien' und bevorzugt von vertraglicher Natur (d.h. keine zeitlich nicht begrenzten Verpflichtungen) mit der Möglichkeit des Austritts -, die genau umschriebene Bereiche betreffen. Historisch gesehen wurden solche Verträge von Staatsoberhäuptern geschlossen, die die Souveränität des Nationalstaates verkörperten. In der moderneren Version werden solche Verträge von einer Regierung geschlossen, die sich gegenüber einem nationalen Parlament verantworten muß - wobei oftmals sogar eine parlamentarische Zustimmung notwendig ist - und den materiellen Bedingungen der nationalen demokratischen Verfassung unterworfen ist. Demokratie ist auf diese Weise sichergestellt.
Einige Passagen in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts - besonders in ihrer 'weichen' Version - scheinen diese Schlußfolgerung zu widerlegen. Immerhin schreibt das Gericht, daß "mit dem Ausbau der Aufgaben und Befugnisse der Gemeinschaft die Notwendigkeit [wächst], zu der über die nationalen Parlamente vermittelten demokratischen Legitimation und Einflußnahme eine Repräsentation der Staatsvölker durch ein europäisches Parlament hinzutreten zu lassen, von der ergänzend eine demokratische Abstützung der Politik der Europäischen Union ausgeht" [40]. Dies aber beweist nur die Inkonsistenz der verfassungsgerichtlichen Argumentation. In seinem Versuch, sich selbst in einer Linie mit den eher traditionellen Vorschlägen zur Demokratisierung der Union durch eine Stärkung des Europäischen Parlaments zu positionieren, begibt sich das Bundesverfassungsgericht in scharfen Widerspruch zu seinem eigenen, ausdrücklich vorgetragenen Verständnis von Demokratie und deren Nexus zum Demos. In Anbetracht der Verneinung eines europäischen Demos durch das Gericht stellt die Formel von der "Repräsentation der Staatsvölker durch ein Europäisches Parlament" schlechtestenfalls nichts als eine leere rhetorische Figur dar im Widerspruch zu den eigenen Überzeugungen des Verfassungsgerichts, bestenfalls eine ebenso widersprüchliche Ausnahme von einem ansonsten in die Gegenrichtung verlaufenden Argumentationsstrom.
Dies also macht nun die Kein-Demos-These aus, die, wie es scheint, einer ausgeprägten Sorge um demokratische Strukturen und Prozesse entspringt, wobei diese jedoch auf der Existenz eines Demos beruhen müssen. Ob es nun einen europäischen Demos gibt oder nicht, es ist schwer zu sehen, wie auf der bereits existierenden Stufe europäischer Integration, sowohl vor als auch nach Maastricht, staatliche Strukturen, Prozesse und Institutionen alleine - das Bundesverfassungsgericht selbst eingeschlossen - in der Lage sein sollen, angemessene demokratische Garantien für das Europäische Haus zu geben. Um es auf den Punkt zu bringen: Wenn es das Anliegen des Bundesverfassungsgerichts war, den demokratischen Charakter des Europäischen Hauses in seiner zukünftigen Entwicklung sicherzustellen, und wenn es die explizite und implizite These des Gerichts ist, daß mangels eines europäischen Demos Demokratie nur durch mitgliedstaatliche Mechanismen garantiert werden kann, dann ist schwer einzusehen, wie das Bundesverfassungsgericht - unter Anwendung desselben Verständnisses - der bereits existierenden Europäischen Union und Gemeinschaft ein demokratisches Gütesiegel erteilen konnte.
Was immer die Absichten der 'Hohen Vertragschließenden Parteien' waren, die Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und Union haben sich auf eine Art und Weise entwickelt, für die es keine internationale Parallele gibt, und nationale Verfahren zur Sicherung demokratischer Kontrolle über internationale Abkommen eines Staates sind offensichtlich schlecht dazu geeignet und jämmerlich unangemessen, um die durch die Europäische Union gestellten Probleme anzusprechen.
Die Problematik der Demokratie in der europäischen Union ist gut erforscht. Sie wird häufig als 'Demokratie-Defizit' der Gemeinschaft bezeichnet, doch gleich welche Terminologie man verwendet, die wesentlichen Punkte sind offensichtlich. Hier ein kurzer Überblick:
Im Zuge der europäischen Integration wurden zahlreiche, und zunehmend wichtigere, Regierungsfunktionen auf 'Brüssel' übertragen, in die exklusive oder konkurrierende Zuständigkeit der Gemeinschaft und Union verlagert. Dies ist in mehrerlei Hinsicht problematisch.
Obwohl die formalen politischen Grenzen der Staaten intakt geblieben sind, wurden in den Bereichen, in denen eine Kompetenzübertragung auf die Union stattfand, die funktionalen politischen Grenzen des Gemeinwesens in der Tat neu gezogen. Wenn wichtige politische Entscheidungen, etwa im Zusammenhang mit internationalem Handel, Umweltschutz, Konsumentenschutz oder Einwanderung, ausschließlich oder überwiegend in den Verantwortungsbereich der Gemeinschaft fallen, dann ist für diese Angelegenheiten der Entscheidungsort nicht mehr der Staat, sondern die Union.
Selbst wenn die Union in ihrem Regierungssystem die exakt gleichen institutionellen Strukturen widerspiegeln würde, wie man sie in den Mitgliedstaaten vorfindet, dann würde das eine Verringerung der spezifischen Bedeutung, des politischen Gewichts und des Umfangs der Kontrollmöglichkeiten jedes Individuums innerhalb der neu gezogenen politischen Grenzen bedeuten. Das ist, so kann man argumentieren, die unvermeidliche Konsequenz der Erweiterung der Mitgliedschaft im funktionalen Gemeinwesen (wenn ein Unternehmen neue Aktien ausgibt, dann wird das Gewicht jeder Stimme in der Aktionärsversammlung verringert) und der Hinzufügung einer zusätzlichen Regierungsebene, welche die Union weiter von ihren eigentlichen Subjekten entfernt, in deren Namen und für die eine demokratische Regierungsform doch arbeiten soll. Wenn man hierfür eine Bezeichnung sucht, so könnte man es 'umgekehrten Regionalismus' nennen. Alle wirklichen und unterstellten Vorzüge des Regionalismus sind hier umgekehrt.
Umgekehrter Regionalismus vermindert nicht einfach Demokratie im Sinne einer Entmachtung des Individuums, sondern er fördert auch das davon getrennte Phänomen der De-Legitimierung. Demokratie und Legitimation sind nicht gleichbedeutend. Man kennt aus der Geschichte Gemeinwesen, bei denen man mit Recht von demokratischen Strukturen und Prozessen ausgehen kann, die jedoch eine zweifelhafte politische Legitimität besaßen und die, auf demokratische Weise, durch Diktaturen ersetzt wurden. Man kennt aus Geschichte und Gegenwart Gemeinwesen mit extrem undemokratischen Regierungsstrukturen und -prozessen, die nichtsdestotrotz ein hohes Maß and Legitimität besaßen oder besitzen. [41] Umgekehrter Regionalismus, in dem Umfange, in dem er Demokratie im oben beschriebenen Sinne vermindert, oder in dem Umfange, in dem man diesen Effekt annimmt, wird in mehr oder weniger großem Ausmaße die Legitimität der Union in Frage stellen.
Die so wahrgenommene Schädlichkeit des umgekehrten Regionalismus und seine delegitimierende Wirkung werden durch drei Faktoren verstärkt:
Die Ausdehnung der Gemeinschaft oder Union in Bereiche, die klassische, symbolische Staatsfunktionen sind oder zumindest als solche aufgefaßt werden, und wo 'uns' (Franzosen, oder Dänen, oder Iren, usw.) 'andere' nicht vorschreiben sollen, wie wir unser Leben zu gestalten haben. Diese sozial konstruierten und kulturell bestimmten Bereiche sind nicht eindeutig festgelegt. Sie reichen vom Lächerlichen (das britische Pint) zum Sublimen (dem Recht auf Leben der irischen Abtreibungs-Saga).
Die Ausdehnung der Gemeinschaft oder Union in Bereiche, die als Angelegenheiten des Einzelnen oder lokaler Gemeinschaften gelten oder zumindest als solche aufgefaßt werden, und in bezug auf die 'uns' (den Individuen) die 'Regierung' nicht vorschreiben soll, wie wir unser Leben zu gestalten haben.
Der Eindruck, ob er nun der Realität entspricht oder nicht, daß es keine effektive Begrenzung und/oder Kontrolle der Fähigkeit der Gemeinschaft oder Union gibt, in Bereiche einzugreifen, die bisher als Domäne des Staates oder des Individuums aufgefaßt wurden.
Umgekehrter Regionalismus ist nur ein Aspekt des beklagten Demokratieproblems der europäischen Integration. Ich habe oben ausgeführt: "Selbst wenn die Union in ihrem Regierungssystem die exakt gleichen institutionellen Strukturen widerspiegeln würde, wie man sie in den Mitgliedstaaten finden kann, dann würde das eine Verringerung der spezifischen Bedeutung, des politischen Gewichts und des Umfangs der Kontrollmöglichkeiten jedes Individuums innerhalb der neu gezogenen politischen Grenzen bedeuten." Aber natürlich spiegelt die Union nicht die nationalstaatlichen demokratischen Einrichtungen wider.
Ein Bestandteil des demokratischen Prozesses in den Mitgliedstaaten ist, mit vielen Variationen natürlich, daß die Regierung, die Exekutive, wenigstens formell der parlamentarischen Kontrolle unterliegt. Insbesondere wenn politische Programme Gesetzgebung erfordern, ist die Zustimmung des Parlaments notwendig. Nationale Parlamente erfüllen, abgesehen von der Ausübung dieser 'Machtfunktionen', auch eine 'Öffentlichkeitsfunktion', verschiedentlich beschrieben als Information, Kommunikation, Legitimation usw. Es wird nun argumentiert, daß die Ausübung von Regierungsgewalt durch die Gemeinschaft und die Union und die Institutionen der Union nachteilige Auswirkungen auf diese grundsätzlichen demokratischen Prozesse innerhalb der Mitgliedstaaten und innerhalb der Union selbst haben.
Die Ausübung von Regierungsgewalt durch Gemeinschaft und Union stört die Machtbalance zwischen Exekutiv- und Legislativorganen eines Staates. Die Exekutive der Mitgliedstaaten, Minister, werden innerhalb der Gemeinschaft als Hauptgesetzgebungsorgan eingesetzt, das, wie bereits erwähnt, eine sich ständig erweiternde Kompetenz über anwachsende Politikfelder besitzt. Der Umfang, die Komplexität und das Timing des innergemeinschaftlichen Entscheidungsprozesses machen die Kontrolle durch die nationalen Parlamente, insbesondere in den großen Mitgliedstaaten, eher zur Illusion denn zur Realität. In einem von Mehrheitsentscheidungen bestimmten Umfeld ist die Möglichkeit der nationalen Parlamente, Ergebnisse innerhalb des Ministerrates zu beeinflussen, noch weiter beeinträchtigt. Das Europäische Parlament bietet hier keinen ausreichenden Ersatz. Selbst nach Maastricht ist die parlamentarische Kontrolle durch das Europäische Parlament in wesentlichen Teilen lückenhaft. Nach dieser Lesart resultiert die Ausübung von Regierungsgewalt durch die Union in einer Nettostärkung der Exekutive innerhalb der Mitgliedstaaten.
Das Europäische Parlament ist nicht nur schwach aufgrund des formalen Fehlens bestimmter Kompetenzen, sondern auch aufgrund seiner strukturellen Abgelegenheit. Die technische Möglichkeit der Mitglieder des Europäischen Parlaments, ihren Wahlkreis in den Gemeinschaftsprozeß einzubinden und ihn zu repräsentieren, wird in den größeren Mitgliedstaaten bereits durch die bloße Größe der Wahlkreise ernsthaft in Frage gestellt. Auch die abstrakte Funktion des Parlaments als Repräsentant "des Volkes" - seine Funktion als öffentliches Forum - wird in Frage gestellt; Ursache ist eine Kombination ineffektiver Kompetenzen des Europäischen Parlaments (die wirklichen Entscheidungen fallen nicht dort), seiner Arbeitsweise (Ort und Zeit), seines Sprach-"Problems" und der Schwierigkeit adäquater Medienberichterstattung (und dem Desinteresse daran). Es ist vielsagend, daß trotz einer schrittweisen Erweiterung der formellen Kompetenzen des Parlaments gleichzeitig ein Rückgang der Wahlbeteiligung bei Europawahlen zu verzeichnen ist. Auch werden Europawahlen von der jeweiligen nationalen politischen Agenda bestimmt und nur allzu häufig als Stimmungsbarommeter für die regierenden nationalen Parteien in der Mitte einer Legislaturperiode betrachtet. Dies ist - eine ebenfalls bemerkenswerte Tatsache - genau das Gegenteil des amerikanischen Systems, in dem Wahlen auf der Ebene der Bundesstaaten häufig ein Signal für die Regierung in Washington sind. Daß wirklich trans-europäische politische Parteien bisher nicht auf den Plan getreten sind, ist ein weiterer Ausdruck dieses Phänomens. Damit gibt es keinen wirklichen Weg, auf dem der europäische politische Prozeß es den Wählern erlauben würde, "die Schurken hinauszuwerfen" - d.h. die oft wirklich letzte verbleibende Macht des Volkes zu ergreifen und eine regierende Gruppe durch eine andere zu ersetzen. Im gegenwärtigen Zustand hat niemand, der bei einer Europawahl seine Stimme abgibt, die Vorstellung, wichtige politische Entscheidungen auf europäischer Ebene zu beeinflussen, und noch viel weniger, die Art der Regierungsausübung in Europa zu bestätigen oder zurückzuweisen.
Die Ausübung von Regierungsfunktionen durch die Gemeinschaft kann sich auch dann als verzerrend auswirken, wenn man einen neo-korporatistischen Blickwinkel hinsichtlich des europäischen Gemeinwesens einnimmt. Aus dieser Perspektive monopolisiert die Regierung - sowohl Exekutive als auch Legislative - nicht den politischen Entscheidungsprozeß, sondern ist nur ein Akteur, wenn auch ein wichtiger, in einer größeren Arena, die öffentliche und private Interessengruppen umfaßt. Die Bedeutung des Parlaments in diesem Modell liegt darin, diffusen und fragmentierten Interessen, deren politischer Einfluß auf ihrer Bedeutung als potentielle Wählerschaft und dem Streben der Politiker nach Wiederwahl beruht, Stimme und Gewicht zu verleihen. Andere Akteure, wie etwa große Industrieverbände oder die Gewerkschaften, deren Interessenzuordnung viel weniger diffus und fragmentiert ist, üben politischen Einfluß durch andere Kanäle und mit anderen Mitteln aus, etwa durch Spenden, durch Kontrolle von Parteiorganisationen und durch direktes Lobbying gegenüber der Verwaltung. Wenn Kompetenzbereiche auf Europa übertragen werden, so bedeutet das an sich schon eine Schwächung diffuser und fragmentierter nationaler Interessen; es ist für diese nämlich schwieriger, sich auf transnationaler Ebene zu organisieren, verglichen etwa mit einem kompakteren Verbund großer Produzenten (etwa in der Tabakindustrie). Zusätzlich haben die strukturellen Schwächen des Europäischen Parlaments einen entsprechenden Effekt auf diese Interessen, selbst wenn sie organisiert sind. Die Wählerschaft besitzt einfach wenig Gewicht in der Europapolitik.
Da die Rechtsakte der Gemeinschaftsgesetzgebung auf der obersten Stufe der Normenhierarchie jedes Landes stehen, wird die nationale gerichtliche Kontrolle primärer Gesetzgebung - in den Systemen, die eine solche besitzen (z.B. Italien, Deutschland, Irland) - ebenfalls geschwächt. Der Europäische Gerichtshof, ebenso wie das Europäische Parlament, bietet, so kann man argumentieren, keinen effektiven Ersatz, da er notwenigerweise von einem anderen gerichtlichen Verständnis angeleitet wird, insbesondere im Hinblick auf die Interpretation der Schranken der Gemeinschaftskompetenzen. Da die Regierungen der Mitgliedstaaten nicht nur das einflußreichste Gesetzgebungsorgan der Gemeinschaft bilden, sondern auch die wichtigste Exekutivfunktion wahrnehmen (sie sind in viel größerem Maße als die Kommission verantwortlich für die Implementierung und Durchführung von Gemeinschaftsrecht und -politik), entgehen sie im Hinblick auf den Großteil ihrer Administrativfunktion auch der Kontrolle durch nationale Parlamente (die typischerweise schwach ist) und durch nationale Gerichte (die typischerweise stärker ist).
Nationale Präferenzen werden, so kann man mit gutem Grund behaupten, ebenfalls in substantieller Weise verfälscht. Ein Mitgliedstaat hat vielleicht eine Mitte-Rechts-Regierung gewählt und kann sich doch mit einer Mitte-Links-Politik konfrontiert sehen, wenn eine Mehrheit von Mitte-Links-Regierungen den Ministerrat dominieren sollte. Umgekehrt, selbst wenn es eine Mehrheit von Mitte-Rechts-Regierungen im Ministerrat geben sollte, kann es sein, daß diese sich durch eine Minderheit von Mitte-Links-Regierungen - oder sogar durch eine einzige derartige Regierung, wenn die Entscheidungsregel Einstimmigkeit vorsieht - blockiert sehen. Sowohl im Ministerrat als auch im Europäischen Parlament ist das Prinzip der proportionalen Repräsentation nur begrenzt verwirklicht, wobei den Bürgern kleiner Staaten, vor allem Luxemburg, verstärktes Gewicht zukommt, während die Bürger der größeren Staaten und vor allem Deutschlands nur eine unzureichende Stimme besitzen.
Zuletzt ein Punkt, von dem gesagt wird, daß er die Ausübung von Regierungsfunktionen durch die Gemeinschaft insgesamt beeinträchtige und den demokratischen Prozeß negativ beeinflusse, nämlich die insgesamt fehlende Transparenz. Diese ist nicht nur ein Ergebnis der zusätzlichen Regierungsebene und der verstärkten Distanz der Regierung. Das Gemeinschaftsverfahren selbst ist notorisch langwierig, in den einzelnen Politikbereichen höchst unterschiedlich und zum Teil ohne Einblicksmöglichkeit für die Öffentlichkeit. "Komitologie" ist ein treffender Neologismus - ein Phänomen, das seine ureigene Wissenschaft erfordert und das bisher noch keine Einzelperson gemeistert hat.
Selbst wenn man nicht alle Details dieser Kurzversion des Demokratiedefizits akzeptiert - kann man ernsthaft argumentieren, daß sie völlig falsch sei? Daß es in der Gemeinschaft von heute kein ernsthaftes Demokratieproblem gebe? Ironischerweise betont und verstärkt die Kein-Demos-These das Problem, da sie als Konsequenz nach sich zieht, daß der bescheidene Zuwachs an Entscheidungkompetenz für das Europäische Parlament nicht zur Lösung des Demokratie-Dilemmas beitragen kann; nach der Kein-Demos-These genießt das Europäische Parlament - wie oben erklärt - in Abwesenheit eines europäischen Demos ja keine unabhängige Autorität und Legitimität als Gesetzgebungsorgan im Gemeinwesen.
Dies ist nicht der Ort, um detaillierte Maßnahmen zur Behebung des Demokratiedefizits der Europäischen Union darzulegen. Aber ich würde behaupten, daß eine realistische Beurteilung des Problems nahelegt, daß, wenn man nicht einen guten Teil der bestehenden Struktur abtragen und Europa nicht zahlreiche Kompetenzen wieder zugunsten der Mitgliedstaaten abringen will, der einzige Weg, ein gewisses Maß an Demokratisierung zu erreichen, eine kombinierte Revision von Kompetenzen und Entscheidungsprozessen sowohl auf der europäischen Ebene als auch auf der der Mitgliedstaaten ist. Ich würde zum Beispiel vehement dafür eintreten, daß die nationalen Parlamente in kritischen Bereichen der Entscheidungsfindung der Union stärker einbezogen werden und/oder effektive, nicht bloß symbolische Kontrolle über die Legislativtätigkeit der nationalen Minister auf der europäischen Ebene erhalten. Aber dies alleine wird das Problem nicht lösen, etwa in den Bereichen, in denen die Union ausschließliche Kompetenzen besitzt und die Mitgliedstaaten daher einfach ihre Regelungskompetenz verloren haben, oder dort, wo die Ausübung von Regierungsgewalt durch die Gemeinschaft auf der Management- und Verwaltungsebene sich einfach der Kontrolle entzieht. Es ist klar, daß die Kompetenzen des Europäischen Parlaments in bestimmten Bereichen gestärkt werden müssen. Aber auch das wird aus den oben erläuterten Gründen das Defizit auch nicht beheben. Nur ein kombiniertes Vorgehen auf nationaler und transnationaler Ebene kann wirkliche Auswirkungen auf das Problem der Demokratie haben. Dies kann kaum erstaunen, da die Union eindeutig weniger als ein Staat, aber ebenso eindeutig mehr als eine klassische internationale Organisation ist.
Wenn dies zutrifft, so bringt es die Befürworter der Kein-Demos-These in eine etwas komplizierte Lage. Nehmen wir die Position des Bundesverfassungsgerichts. Indem es die Kein-Demos-These vertritt, betont es die Schwere des Demokratiedefizits dadurch, daß es den gegenwärtig erweiterten Kompetenzen des Europäischen Parlaments jede Demokratisierungswirkung abspricht. Und doch erteilt es gleichzeitig durch die Zustimmung zum Vertrag von Maastricht nolens volens das Siegel 'demokratischer Gesundheit'. Wie ist das möglich? - Durch, wie mir scheint, eine der folgenden Überlegungen:
- Man könnte einer Fiktion anhängen, den Kopf in den Sand stecken und so tun, als ob die gegenwärtigen Probleme gar nicht existierten. Die Mängel der Gemeinschaft in Sachen Demokratie, die es bereits lange vor Maastricht gab und die Maastricht nicht geheilt hat, hervorzuheben, würde die Aufmerksamkeit auf das Versagen des Bundesverfassungsgerichts lenken, bei früheren Gelegenheiten das Demokratiedefizit zu erkennen und auf einer Behebung zu insistieren. Aber wenn der Strauß seinen Kopf in den Sand steckt, ist ausschließlich er realitätsblind. Wie würde sich das auf die Glaubwürdigkeit des Gerichts als zukünftigem Garanten der Demokratie auswirken? Wenn man das Problem heute nicht sieht, warum sollte man es morgen ansprechen ? Zu meinem Leidwesen findet sich ein wenig von diesem Vogel- Strauß-Syndrom in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.
- Man könnte explizit oder implizit [42] annehmen, daß der gegenwärtige Stand der Union durch nationale Prozesse demokratisch legitimiert worden ist - zum Beispiel durch die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat zur Gemeinschaft. Dies jedoch ist problematisch und auch ein wenig billig. Erstens, selbst wenn, wie ich an anderer Stelle eingeräumt habe [43], die gegenwärtige Union durch die Zustimmung zu den Vertragsergänzungen (wie der Einheitlichen Europäischen Akte und den verschiedenen Abkommen zum Beitritt neuer Mitgliedstaaten) sukzessive demokratisch abgesegnet wurde, ist dies doch eine sehr formale Betrachtung demokratischer Legitimation. Erinnert das nicht ein wenig an die Wahlen in der Weimarer Republik, die ein nicht-demokratisches Regime demokratisch bestätigten? Ist es nicht die Aufgabe eines Verfassungsgerichts, ein Gegengewicht zu einer derartigen selbstzerstörerischen Demokratie zu bilden? Die Vermittlung durch die Mitgliedstaaten hat in der Tat wesentliche Auswirkungen auf die soziale und formale Legitimation des Europäischen Hauses, aber sie hat nur wenig dazu beigetragen, das Problem mangelhafter demokratischer Strukturen und Prozesse anzugehen. Wenn das Bundesverfassungsgericht das gegenwärtige demokratische Problem der Union durch die einfache Tatsache als gelöst ansähe, daß nationale Parlamente das Vertragspaket auf die eine oder andere Weise bestätigt haben, dann würde sich das Gericht schlimmstenfalls in eine andere Form der Fiktion über die Realität der Union und die demokratisierende Kraft nationaler Strukturen und Institutionen flüchten, bestenfalls in die Annahme eines formalen und ärmlichen Verständnisses dessen, was zur Sicherstellung von Demokratie im Gemeinswesen notwendig ist. So oder so - es verheißt nichts Gutes für unser Vertrauen in die Fähigkeit des Bundesverfassungsgerichts, als effektiver Hüter demokratischer Strukturen und Prozesse zu firmieren.
- Hinsichtlich der Demokratisierung auf europäischer Ebene scheint das Bundesverfassungsgericht auf verlorenem Posten zu stehen. Wenn es einen weiteren Kompetenzzuwachs des Europäischen Parlaments (insbesondere auf Kosten nationaler Institutionen) erlaubt, untergräbt es die Kein-Demos-These. Wenn es einen derartigen weiteren Kompetenzzuwachs nicht erlaubt, schließt es meiner Ansicht nach für immer die Lösung des Demokratieproblems der Gemeinschaft aus, denn obwohl Demokratisierung auf europäischer Ebene allein nicht ausreichend ist, so stellt sie doch zumindest eine notwendige Bedingung für die Beseitigung der demokratischen Malaise dar.
Ich kann nur spekulieren, wie das Bundesverfassungsgericht sich in diese Reihe unhaltbarer Optionen hineinmanövrierte. Die europäische Integration wurde immer als positives Element in der deutschen Politik gesehen, erstrebenswert an sich, aber auch als Hauptplattform für eine deutsche Wiederlegitimierung nach 1945. Sie war jedoch bis vor kurzem kein politisches und/oder intellektuelles Anliegen des Gerichts und seiner Richter. Das traf, wie ich vermute, auch für die große Mehrzahl der deutschen Professoren des Öffentlichen Rechts zu. Europäisches Gemeinschaftsrecht war für viele Jahre die ausschließliche Domäne einer relativ kleinen Gruppe von Wissenschaftlern und Praktikern. [44] Während sich die Aufmerksamkeit in Karlsruhe auf andere Gebiete richtete, machte die Gemeinschaft weitreichende Verfassungswandlungen durch, inhaltlich unterschiedlicher Art aber ebenso radikal etwa wie diejenigen, die durch den amerikanischen Verfassungskonvent von Philadelphia ausgelöst wurden, und sicherlich ebenso tiefgreifend wie irgendeine Wandlung, der im Vertrag selbst ausdrücklich zugestimmt wurde. In meiner eigenen Studie The Transformation of Europe [45] versuche ich, nicht nur die Natur solcher Wandlungen zu erklären, sondern auch, wie radikale Entwicklungen - etwa die Auflösung verfassungsmäßiger Garantien einer nur beschränkten Gemeinschaftszuständigkeit, die in den 70er (!) Jahren stattfand - ohne große politische und juristische Diskussion geschehen konnte. [46] In einer anderen Studie Journey to an Unknown Destination: A Retrospective and Prospective of the European Court of Justice in the Arena of Political Integration [47] spekuliere ich über die Gründe dafür, warum sich im Bereich der Europäischen Integration erst so spät eine interne kritische Perspektive entwickelt hat. Wie dem auch sein mag, erst die Einheitliche Europäische Akte 1986 (die das Mehrheitsprinzip in der Gemeinschaft "wiederherstellte" und damit Fragen der Legitimität und Demokratie aufwarf [48]) und der Vertrag von Maastricht in den frühen 90er Jahren weckten ernsthaftes Interesse an der Gemeinschaft bei einem größeren Kreis von Verfassungsrechtlern. Die erbitterte Debatte um Maastricht und die weitverbreitete Ablehnung in der Bevölkerung haben eine neue kritische Perspektive angestoßen. Zu dieser Zeit jedoch war der Zug längst abgefahren. Als das Karlsruher Dornröschen aus seinem Schlaf erwachte, war kaum noch etwas zu machen am status quo: Sollte man im Namen der Demokratie erklären, daß das Problem nicht Maastricht war, sondern das, was zuvor passierte? (Eines sollte ganz klar sein: Maastricht - sollte es auch nicht ausreichend sein - verbessert aus demokratischer Perspektive den Zustand der Demokratie in der Gemeinschaft!) Die Europäische Gemeinschaft schließen? Auf einen deutschen Austritt beharren? - Alles politisch abstrus und rechtlich unmöglich. Außerdem würde dann die Frage gestellt werden nach dem merkwürdigen Fehlen dieses demokratischen Bewußtseins zu der Zeit, als das Gericht seine hoch gehandelten Solange I [49] und Solange II [50]Entscheidungen fällte. So scheint es, daß der einzige Ausweg darin bestand, die Vergangenheit im Wege dieses schwachen Konzepts der demokratischen Vermittlung durch die Mitgliedstaaten zu rechtfertigen und damit das Signal auszusenden, daß der deutsche Konstitutionalismus nicht noch einmal bei einem Nickerchen erwischt werden wird.
Das Bundesverfassungsgericht hätte eine andere Lösung wählen können: Nämlich die demokratischen Schwächen der Gemeinschaft herausstellen - wie unbequem dies auch immer sein mag -, die Maastricht nicht behoben hat und die alle europäischen und mitgliedstaatlichen Institutionen (einschließlich der Gerichte) stillschweigend geduldet haben. Da die Union aber, trotz dieser Schwächen, formal legitimiert war [51], hätte das Gericht zum Beispiel den Vertrag für verfassungsmäßig erklären und gleichzeitig darauf bestehen können, daß die existierende Kluft zwischen formaler Legitimation und materiellem Demokratiedefizit nur als vorübergehend angesehen werden darf und mittel- und langfristig nicht akzeptiert werden kann. Auf diese Weise hätte das Bundesverfassungsgericht seine große Autorität hinter die Bestrebungen zur Demokratisierung gestellt.
Diese Option jedoch käme nicht umhin, neben anderen Maßnahmen die Notwendigkeit einer Stärkung etwa des Europäischen Parlaments anzuerkennen. Man kann es nicht ernst mit der Demokratie in Europa meinen und gleichzeitig glauben, daß angesichts der gegenwärtigen Fülle von Macht und Kompetenzen, die bereits auf die Union übertragen wurde, Demokratisierung ausschließlich auf der nationalen Ebene stattfinden kann. Diese Konstruktion erschien dem Bundesverfassungsgericht, wie ich vermute, sogar noch bedrohlicher. Warum? Das ist eines der Rätsel der Entscheidung. Wie ich versuchen werde zu zeigen, hat sich das Gericht, trotz all seiner Ausführungen über Demokratie, durch das Verständnis, das es von Volk, Staat und Staatsangehörigkeit hat in eine noch unhaltbarere Situation manövriert.
Kurz gesagt: Wenn die Richter, die die Entscheidung unterstützten, wirklich glauben, daß ein Gemeinwesen, um demokratische Autorität und legitime Gesetzgebungskompetenz zu besitzen, auf der Verschmelzung von Volk, Staat und Staatsangehörigkeit beruhen muß, daß der einzige Weg, sich den Demos eines derartigen Gemeinwesens vorzustellen, in mehrschichtigen homogenen, organisch-kulturellen Begriffen liegt, dann stellt die Zukunft der europäischen Integration eine große Bedrohung dar, ob man dies zugeben will oder nicht. Das Problem ist nicht, daß es gegenwärtig keinen europäischen Demos gibt; das Problem ist, daß es eines Tages möglicherweise einen geben wird. Und warum ist das ein Problem? Weil nach diesem Verständnis von Gemeinwesen und Demos die Entstehung eines europäischen Demos, der in einem europäischen Gemeinwesen legitime Autorität besitzt, die Ersetzung der verschiedenen Demoi der Mitgliedstaaten, einschließlich des deutschen Volkes, bedeuten würde. Ich stimme zu, daß dies ein zu hoher Preis für die europäische Integration wäre. Da aber nach dem Verständnis des Gerichts nur eine binäre Option existiert - entweder ein europäischer Staat (ein europäisches Volk) oder ein Staatenverbund (mit der Bewahrung aller europäischen Völker - einschließlich des deutschen) - ist diese Angst unvermeidlich.
Ich werde zu zeigen versuchen, daß diese Auffassung auf einer oder vielleicht sogar zwei grundlegenden Fehlkonzeptionen mit nachteiligen Konsequenzen sowohl für Deutschland selbst (so glaube ich) und für Europa (hier bin ich mir sicher) beruht. Meine Kritik richtet sich nicht gegen das ethno-kulturelle, homogene Konzept des Volkes als solches, sondern gegen die Auffassung, daß der einzige Weg, sich einen Demos vorzustellen, der einem Gemeinwesen legitime Gesetzgebungsmacht und demokratische Autorität verleiht, in diesen volksbezogenen Begriffen liegt. Ebenso kritisiere ich die damit einhergehende Vorstellung, daß der einzige Weg, sich ein legitime Gesetzgebungsmacht und demokratische Autorität genießendes Gemeinwesen vorzustellen, in staatlichen Formen liegt. Schließlich kritisiere ich das der Entscheidung implizite Verständnis, daß der einzige Weg, sich die Union vorzustellen, in einer staatlichen Form liegt: Staat, Staatenbund, Bundesstaat, Staatenverbund. Bemerkenswert ist nicht nur die 'Versklavung' unter das Konzept des Staates, sondern auch, wie wir sehen werden, die Unfähigkeit, sich eine Entität mit mehreren nebeneinanderstehenden Identitäten zu vorzustellen. Polyzentrisches Denken ist offensichtlich inakzeptabel.
Ich werde meine Kritik Schritt für Schritt darlegen und mit dem Verständnis von Demos als Volk beginnen. Ich möchte drei mögliche Einwände gegen die bundesverfassungsgerichtliche Version der Kein-Demos-These und ihre Implikationen formulieren.
Der erste Einwand hat zwei Stränge. Der eine, weniger zwingend, argumentiert, daß die Kein-Demos-These einfach die anthroplogische Landkarte Europas fehlinterpretiert: daß nämlich in der Tat ein europäisches Bewußtsein sozialen Zusammenhaltes, einer gemeinsamen Identität und eines kollektiven Ich existiert, das wiederum in Loyalität resultiert (und diese auch verdient) und das damit den europäischen Institutionen potentielle Autorität und demokratische Legitimität verleiht. Kurz: daß, ob man will oder nicht, ein europäisches Volk existiert, wie es die Kein-Demos-These fordert, und daß das einzige Demokratieproblem in der Gemeinschaft in Prozeßdefiziten wie etwa der Schwäche des Europäischen Parlaments liegt, nicht jedoch in der grundsätzlichen strukturellen Abwesenheit eines Demos. Zwar existiert keine gemeinsame europäische Sprache, doch kann dies als solches noch keine conditio sine qua non sein, wie etwa das Beispiel der Schweiz zeigt. Außerdem gebe es ein ausreichendes Maß an gemeinsamer Geschichte und gemeinsamen kulturellen Gewohnheiten, um die die Vorstellung von einem europäischen Demos aufrechterhalten zu können. Das Problem mit dieser Konstruktion ist, daß sie einfach nicht zutrifft. [52] Für die meisten Europäer wäre jede Vorstellung einer europäischen Identität, definiert in organisch-kulturellen oder nationalen Begriffen, extrem befremdlich. Ich will diese Kritik als solche daher nicht weiter verfolgen.
Allerdings gibt es einen Strang dieses ersten Einwandes, der es wert ist, aufgegriffen zu werden. Man kann argumentieren, daß Volkszugehörigkeit und nationale Identität in bestimmten kritischen Übergangsphasen ein weitaus größeres Maß an Künstlichkeit, an sozialer Konstruktion und gar 'Social Engineering' besitzen, als die organische, volksbezogene Auffassung zugestehen würde. So gesehen sind sie viel fließender, potentiell instabil und veränderlich. Sie können fraglos als bewußte Entscheidung konstruiert werden und müssen nicht unbedingt eine Reflexion eines bereits existierenden Bewußtseins sein. Wie könnte man sich jemals eine politische Vereinigung vorstellen, wenn man strikt diesem Verständnis von Volkszugehörigkeit folgen würde? Bei der Entstehung derjenigen europäischen Staaten, die eine Vereinigung mit sich brachten, wie etwa Deutschland und Italien, ging der Akt der formalen Vereinigung der vollständigen und umfassenden Veränderung des Bewußtseins voraus. Obwohl konzeptionell die Nation Bedingung für den Staat ist, war es historisch gesehen oft der Staat, der die Nation konstituierte, indem er eine Sprache festlegte und/oder einen bestimmten Dialekt privilegierte und/oder eine bestimmte Geschichtsdeutung bevorzugte und/oder kollektive Symbole und Mythen schuf. [53] In einem Vereinigungsprozeß ist dies die oftmals notwendige Reihenfolge der tatsächlichen Abläufe. Man denke etwa an Preußen und Österreich. Wäre es so abwegig, sich eine andere historische Entwicklung vorzustellen, in der Preußen seinen eigenen Weg gegangen wäre, ein partikularistisches Verständnis seiner Geschichte, Symbole, kulturellen Gewohnheiten und Mythen gefördert hätte und ein Verständnis von Volk und Nation entwickelt worden wäre, das all das betont hätte, was es von anderen deutschsprachigen Nationen unterschied, und daß Österreich, in dieser 'was wäre wenn' Vorstellung, einfach ein Teil des vereinigten Deutschlands geworden wäre?
Ich will hier natürlich nicht Stellung beziehen hinsichtlich der Wünschbarkeit oder Nichtwünschbarkeit einer europäischen Vereinigung, die getragen ist vom Konzept der Nation und der Volkszugehörigkei. (Allerdings wird wohl durchscheinen, daß ich sie ablehne.) Jedoch argumentiere ich, daß das Beharren auf der vorangehenden Entwicklung eines europäischen Demos, definiert in organischen nationalen-kulturellen Begriffen, als Voraussetzung für eine verfassungsmäßige Vereinigung oder, minimalistischer, für das Neuziehen politischer Grenzen, gleichbedeutend damit ist sicherzustellen, daß dies niemals geschehen wird. Die Kein-Demos-These, die von ihren Befürwortern als auf empirischer und objektiver Beobachtung gründend dargestellt wird, verbirgt kaum ihr vorherbestimmtes Ergebnis.
Der zweite Einwand ist zentraler und betrifft das Konzept von Zugehörigkeit, das der Kein-Demos-These innewohnt. Wer, so können wir fragen, sind die Angehörigen des Deutschen Gemeinwesens? Die Antwort scheint offensichtlich: Das deutsche Volk, die Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Sie sind der deutsche Demos. Deutschland ist der Staat der Deutschen, definiert in den bekannten ethno-nationalen Kategorien. Vor diesem Hintergrund zu sagen, daß kein europäischer Demos existiert, ist gleichbedeutend mit der Aussage, es gebe keine europäische Nation. Ich sollte gleich hinzufügen, daß ich dem zustimme: Es gibt keine europäische Nation oder und kein europäisches Volk in dem Sinne, in dem diese Begriffe vom Bundesverfassungsgericht und den Staatsrechtslehrern, auf die es sich beruft, verstanden werden.
Das ist jedoch nicht der Punkt. Der eigentliche Punkt ist der folgende: Ist es zwingend, daß Demos allgemein und der europäische Demos im besonderen ausschließlich in den ethno-kulturellen Homogenitäts-Kategorien verstanden werden muß, von denen das Bundesverfassungsgericht in seinem Selbstverständnis ausgeht? Kann es nicht andere Verständnisse von Demos geben, die zu anderen Konzepten und Potentialen für Europa führen? Hat nicht die deutsche Soziologie und politische Theorie selbst eines der in dieser Hinsicht herausforderndsten Konzepte entwickelt, nämlich das des 'Verfassungspatriotismus'?
Ich habe bis hierhin ein Konzept, das im Englischen unter 'citizenship' gefaßt wird, absichtsvoll vermieden. Bevor ich erläutern kann, warum sich hier ein Ausweg aus der Gedankenschleife der Kein-Demos These ergibt, möchte ich klarstellen, wovon ich eigentlich rede.
Im Deutschen stoßen wir auf die Schwierigkeit, daß es eine exakte Entsprechung zu 'citizenship' nicht gibt. [54] Vielmehr wird, jedenfalls terminologisch, unterschieden zwischen 1) dem formal-rechtlichen Band zwischen dem einzelnen und 'seinem' Staat (Staatsangehörigkeit), 2) der partizipatorisch angelegten Zugehörigkeit zum Gemeinwesen im Sinne eines status activus (Staatsbürgerschaft), die Staatsangehörigkeit voraussetzt, und 3) der ethno-kulturellen National- oder Volkszugehörigkeit. Zwar wird diese Terminologie nicht streng durchgehalten, wird doch der Erwerb der Staatsangehörigkeit als Einbürgerung bezeichnet; auch werde ich darauf zurückkommen, daß der terminologischen Trennung in Deutschland gerade keine Unverbundenheit der dahinterstehenden Konzepte entspricht - man muß eben in Deutschland grundsätzlich zum Nationalvolk gehören, um staatsangehörig zu sein und infolgedessen als Staatsbürger zu gelten. Das englische citizenship erfaßt nun vor allem sowohl den formal-rechtlichen (Staatsangehörigkeit) als auch - womöglich noch stärker - den partizipatorischen (Staatsbürgerschaft) Zug im Verhältnis des einzelnen zum Gemeinwesen, ohne dabei jedoch auf den Begriff 'Staat' bereits in der Bezeichnung dieses Verhältnisses rekurrieren zu müssen (darauf wird später zurückzukommen sein). Ich werde im folgenden dort, wo man im Englischen schlicht citizenship gebrauchen würde, versuchen, die Nuance zu treffen und jeweils Staatsangehörigkeit oder Staatsbürgerschaft verwenden.
Dies vor Augen, können wir nicht die Angehörigkeit zu einem Gemeinwesen in staatsbürgerlichen, nicht ethno-kulturellen Begriffen definieren? Sollte es nicht möglich sein, Ethnos von Demos trennen? Und können wir uns nicht ein Gemeinwesen vorstellen, dessen Demos auf den staatsangehörigen Staatsbürger zurückgreifend verstanden und definiert wird und Demos eben nicht in ethno-kulturellen Kategorien begreift, und auf dieser Basis demokratische Autorität zur legitimen Normsetzung besäße? Es gibt mit Sicherheit eine bestimmte deutsche Verfassungstradition, der die Kein-Demos-These entspringt, die diese Möglichkeiten verschleiert: Mindestens seit der Zeit des Kaiserreiches läßt sich eine starke Strömung ausmachen, die auf der Einheit von Volk-Nation-Staat-Staatsangehörigkeit beharrt. Die Begriffe Deutscher Staatsbürger, Staatsangehöriger, Deutscher im Sinne eines Angehörigen der deutschen Nation sowie Angehöriger des Deutschen Volkes sind grundsätzlich - von einigen Ausnahmen abgesehen - deckungsgleich [55]. Zugehörigkeit zum deutschen Volk ist normalerweise die Bedingung für Staatsangehörigkeit. [56] Und Staatsangehörigkeit kann in dieser Tradition eben nur in staatsbezogenen Begriffen verstanden werden. Alleine die Sprache spiegelt das Verschmelzen der Kategorien wieder: das Konzept des Staates ist in dem Begriff 'Staatsangehöriger' fest eingebaut. Staatsangehörigkeit und Staatlichkeit bedingen sich gegenseitig. Dies ist keineswegs lediglich eine Frage der Verfassungstheorie und der politischen Theorie, sondern spiegelt sich auch im positiven Recht wider. So ist die Einbürgerung in Deutschland - soweit sie nicht im Zusammenhnag mit Heirat, Adoption und einigen anderen Ausnahmen erfolgt - ein Akt, der nicht nur die Annahme der mit der Staatsangehörigkeit verbundenen staatsbürgerlichen Pflichten und der Verpflichtung zu Loyalität gegenüber dem Staat beinhaltet, sondern auch das Bekenntnis zur nationalen deutschen Identität in diesem mehtschichtigen, kulturellen Sinne, zum Deutschtum, umfaßt, d.h. eine echte kulturelle Assimilation, welche die Aufgabe anderer volksbezogener Loyalitäten und Identifikationen fordert. [57] So setzte, um ein historische Beispiel zu nennen, die Emanzipation der Juden in Deutschland die Verweisung von Jüdischsein und Judentum in den Bereich der Religion und eine Negierung der Vorstellung eines jüdischen Volkes voraus. [58] Um nach dieser Konzeption ein deutscher Staatsangehöriger zu sein, muß man Teil des Volkes sein. Und in diesen Kategorien ist Deutschland als Staat der Staat der Deutschen.
Entsprechend konnte man bis vor kurzem schon in der dritten Generation in Deutschland leben und dennoch die Staatsangehörigkeit verweigert bekommen, weil man nicht in der Lage oder nicht Willens war, 'Deutscher' in einem kulturellen und identifikatorischen Sinne zu werden. [59] Das Recht verweigert - abgesehen von einigen Ausnahmen - insbesondere denjenigen Personen die Einbürgerung, die zwar bereit wären, sich zu ihren staatsbürgerlichen Pflichten zu bekennen und diese zu erfüllen, aber gleichzeitig eine andere nationale Identität behalten wollen. Mehrfache Staatsangehörigkeit wird in besonderen Fällen geduldet, grundsätzlich aber mißbilligt. [60] Im Gegensatz dazu steht, daß man als ethnisch definierter Deutscher, selbst wenn man in der dritten Generation Staatsangehöriger und Einwohner irgendeines weit entfernten Landes ist, trotzdem als Angehöriger des deutschen Volkes [61] (Volkszugehöriger) eine privilegierte Stellung bei der Einbürgerung erhält [62].
Demnach ist der formal-rechtliche 'Ausweis' der Angehörigkeit zum Gemeinwesen die Staatsangehörigkeit [63]: Staatsangehörigkeit ist das, was jemanden als Angehörigen des Gemeinwesens definiert, mit allen politischen und staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten. Dies wird jedoch wiederum verschmolzen mit Nationalität, d.h. der Zugehörigkeit zum Volk im ethno-kulturellen Sinne. [64] Und da Demos in nationalen Begriffen definiert wird, ist der einzig vorstellbare Demos einer, dem staatsangehörige Staatsbürger einheitlicher Nationalität angehören - also bleibt Demos auf der Ebene des Staates.
Ich sollte darauf hinweisen, daß Deutschland nicht der einzige Staat in Europa oder anderswo ist, dessen Angehörigkeitsphilosophie sich in dieser Form darstellt. In einem gewissen Maße ist dies die Philosophie des Nationalstaates. Aber Deutschland bietet ein eher extremes Beispiel des Verschmelzens von Staat, Volk/Nation und Staatsangehörigkeit.
Wie dem auch sei, diese Verschmelzung ist weder konzeptionell notwendig, noch universell praktiziert und wohl auch kaum erstrebenswert. In einer ganzen Reihe von Staaten zieht beispielsweise die bloße Geburt innerhalb des Staates die Staatsangehörigkeit oder wenigstens einen Anspruch auf die Staatsangehörigkeit nach sich, dies ohne jeden Anspruch darauf, daß man ein Volksangehöriger im ethno-kulturellen Sinne wird. Es gibt Staaten, in denen Staatsbürgertum im Sinne eines Bekenntnisses zu den verfassungsmäßigen Werten und den staatsbürgerlichen Pflichten des Gemeinwesens die Bedingung für eine Einbürgerung ist, während Nationalität im ethno-kulturellen Sinne, ebenso wie Religion, als Angelegenheit persönlicher Präferenzen betrachtet wird. [65] Es gibt Staaten - wie Deutschland - mit einer starken ethno-kulturellen Identität, die trotzdem die Staatsangehörigkeit nicht nur einzelnen anderer Nationalität, die nicht zum Mehrheits-Volk gehören, sondern auch Minderheiten mit ausgeprägten, oft gar konkurrierenden ethno-kulturellen Identitäten verleihen. [66] Letztlich obliegt es den Deutschen zu entscheiden, ob die Einheit von Volk, Staat und Staatsangehörigkeit weiterhin der beste Weg sein wird, ihren Staat, ihre Nation und ihr Staatsbürgertum zu verstehen. Ich werde darauf später zurückkommen.
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts läßt jedoch ein bestimmtes Verständnis nicht nur des deutschen Gemeinwesens und des deutschen Demos, sondern auch von Europa erkennen, insbesondere in der 'Noch Nicht'-Formulierung. Wenn das Gericht uns sagt, daß es noch keinen europäischen Demos gibt, lädt es uns implizit dazu ein, uns Europa, seine Zukunft und sein Ziel in ethno-nationalen Begriffen zu denken. Stillschweigend konstruiert es damit Europa in einer Art vor-staatlichem Zustand, als noch unterentwickelt und daher einer eigenen legitimen Normsetzung und demokratischen Autorität entbehrend. Es ist dieses (Miß)Verständnis, das die entweder-oder Nullsummenbeziehung zwischen Europa und den Mitgliedstaaten nach sich zieht. Wenn der Demos das Volk ist und Angehörigkeit eben nur als Staatsangehörigkeit verstanden werden kann, dann kann ein europäischer Demos und eine europäische "Staats"-Angehörigkeit nur zu Lasten der parallelen deutschen Kategorien entstehen.
Für diese Auffassung unvorstellbar ist die Abkopplung von Nationalität (verstanden im volksbezogenen, ethno-kulturellen Sinne) und Staatsangehörigkeit. Ebensowenig vorstellbar ist ein Demos, der in nicht-organischen staatsbürgerlichen Begriffen verstanden wird, ein Zusammenschluß nicht auf der Basis eines gemeinsamen Ethnos und/oder einer organischen Kultur, sondern auf der Grundlage gemeinsamer Werte, eines gemeinsamen Verständnisses von Rechten und sozialen Pflichten und einer gemeinsamen rationalen intellektuellen Kultur, die ethno-nationale Differenzen überwindet. [67] Weiterhin unvorstellbar ist nach dieser Auffassung das Modell eines Gemeinwesens, das Normsetzungskompetenz und demokratische Autorität besitzt und dessen Demos (und damit das Gemeinwesen selbst einen nicht-staatlichen Charakter hat und anders verstanden wird als im deutschen Selbstverständnis. Schließlich ist aus dieser Perspektive ebenfalls unvorstellbar, daß ein Mitgliedstaat wie Deutschland zum einen sein eigenes Verständnis von Demos für sich selbst (zum Beispiel in der relativ extremen Form von Staat=Volk=Staatsangehöriger Staatsbürger) hegen kann und doch gleichzeitig Teil eines größeren Gemeinwesens mit einem abweichenden Verständnis von Demos ist.
Der Kein-Demos-These liegt letztendlich ein Weltbild zugrunde, das den Konzepten von Volk, Staat und Staatsangehörigkeit hörig erlegen ist und das unfähig ist, die Gemeinschaft oder Union anders als mittels dieser Begriffe wahrzunehmen. Hier findet sich ein weiterer Grund, warum die Union so bedrohlich erscheinen mag, da die staatliche Vision sie nur im Gegensatz zu den Mitgliedstaaten wahrnehmen kann. Dies bedeutet jedoch, der Gemeinschaft oder Union eine externe Vorstellung aufzuzwingen anstatt den Versuch zu unternehmen, sie den ihr eigenen und eigentümlichen Begriffen zu verstehen (oder zu definieren). Dies bedeutet ein Versagen, die Bedeutung und Möglichkeiten von Supranationalismus auch nur zu erfassen.
Bevor wir auf das Potential einer Trennung von Nationalität und Bürgerschaft zurückkommen, erscheint es sinnvoll, die grundlegendere Beziehung zwischen Union, Nation und Staat innerhalb der europäischen Konstruktion, wie sie der Begriff Supranationalität umschreibt, zu diskutieren.
V. Supranationalität: Gemeinschaft, Nation und Staat
Wie aber kann, vor diesem Hintergrund, die Idee der Supranationalität verstanden oder beschrieben werden? An dieser Stelle scheint zunächst etwas Vorsicht geboten. Eine feststehende Bedeutung des Begriffes 'Supranationalität' existiert nicht. Tatsächlich scheint es, seitdem der Begriff verwendet wird, zwei konkurrierende Visionen im Hinblick auf seine Realisierung seitens der Gemeinschaft gegeben zu haben: Eine Einheits- oder Staatsvision - wofür die Befürworter der Vereinigten Staaten von Europa standen - und eine abgeschwächtere Gemeinschaftsvision. Diese beiden Stränge, die natürlich Berührungspunkte aufweisen, existieren nach wie vor nebeneinander. Allerdings ist es meine Lesart der historischen Landkarte - des Scheiterns der EVG und der Europäischen Politischen Gemeinschaft in den 50er Jahren und der Artikulation von Supranationalität insbesondere im EWG-Vertrag -, daß die Gemeinschafts-Vision in den Gründungsjahren der EG vorherrschte.
Bei den Versuchen zu erklären, inwiefern die Gemeinschaft supranational ist oder wurde, tendierte die Diskussion im Laufe der Jahre inWerte und Tugenden des Nationalstaates besorgt sind.
Zur Klärung des Verhältnisses zwischen Supranationalität, Nation und Staatlichkeit sollen im folgenden zunächst jeweils Nation und Staatlichkeit in den Blick genommen und versucht werden, deren Verheißungen und Gefahren auszuloten. In einem nächsten Schritt werden wir dies dann zum Ziel des Konzepts der Supranationalität in Beziehung setzen. Meine Auseinandersetzung mit Staat und Nation muß sich natürlich auf einige wenige Fingerzeige und Schlagworte beschränken, alles andere würde den Rahmen der vorliegenden Abhandlung bei weitem überschreiten.
Bei all dem Gerede über Volk und Nation und unseren Obsessionen im Hinblick auf die Gefahren von Nationalismus, Chauvinismus oder gar Rassismus, von denen oft gesagt wird, daß sie sich aus diesen Konzepten ableiten - was kann über sie auf normativer Ebene gesagt werden? Ich werde mich auf das Konzept der Nation beziehen, jedoch gilt das Gesagte weitgehend auch für das Konzept des Volkes.
Nation - zumindest in der liberalen Konzeption des 19. Jahrhunderts - scheint zwei zutiefst menschlichen Werten Ausdruck zu verleihen: Zugehörigkeit und Originalität.
(Es sollte jedoch gleich festgehalten werden, daß die Nation nicht die einzig denkbare soziale Form ist, in der diese Werte verwirklicht werden können.)
Zugehörigkeit wohnt der Idee der Nation inne, Nation verkörpert eine Form des Dazugehörens. Nation ist kein Instrument, um Zugehörigkeit zu erlangen, Nation ist Zugehörigkeit. Form und Inhalt verschmelzen hier in der gleichen Weise wie etwa in einem Liebessonett von Shakespeare: Der Wert des Sonettes liegt nicht in seiner Liebesbotschaft; wir nehmen das Sonnett nicht als bloßes Instrument zur Übermittlung der Botschaft wahr. Ohne die Form ist die Botschaft banal. Was dem Sonett seinen zeitlosen Wert verleiht, ist die unentwirrbare Art und Weise, in der Inhalt und Form von Shakespeare verwoben wurden.
Welches sind die tieferen Werte, die hinter Zugehörigkeit - nationaler Zugehörigkeit - stehen, über die verbreitete Ansicht hinaus, daß Zugehörigkeit angenehm und gut ist? Wir können ohne weiteres eine gewisse grundlegende Anziehungskraft auf die Menschen verstehen, die vermutlich inhärent sozial ist: die Anziehungskraft, die Familie und Stamm ebenfalls ausüben. Teil dieser Anziehungskraft ist einfach die Bereitstellung eines Rahmens für soziale Interaktion. Dies greift jedoch zweifellos zu kurz: könnten doch viel losere soziale Konstrukte als Nation, oder erst recht als Stamm und Familie, dieses Gerüst bereitstellen. Zugehörigkeit bedeutet sicher mehr als das. Es bedeutet einen Platz zu haben, ein soziales Zuhause.
Die Zugehörigkeit zur Nation ist den Blutsbanden in Familie und Stamm zugleich ähnlich und unähnlich; in sowohl dieser Ähnlichkeit als auch dieser Unähnlichkeit mögen sich Hinweise finden lassen auf die zugrundeliegenden Werte.
Die Ähnlichkeit zu den Blutsbanden in Familie und Stamm besteht darin, daß die der Nation Zugehörigen anerkannt sind, ihren Platz haben, eben dazugehören - dies unabhängig von ihren Leistungen: durch ihr bloßes Sein. Hierin liegt die machtvolle Anziehungskraft (und die schreckliche Gefahr) von Zugehörigkeit dieser Art: sie ist ein Schutzschild gegen das existentielle Alleinesein. In der Tradition der jüdischen Nation zum Beispiel - eine Tradition, die einige Beachtung verdient in Anbetracht des Überlebens dieser Nation über die letzten drei Jahrtausende hinweg - finden wir einen normativen Ausdruck dieser Art von Zugehörigkeit: "Obwohl er gesündigt hat, bleibt er doch Israel." [68]
Die Macht dieser Zugehörigkeit mag verständlich werden, hält man sich deren dramatische und einschüchternde Gegensätze vor Augen: Isolation, Auschluß, Exkommunikation.
Doch Nation transzendiert Familie und Stamm, und vielleicht verbirgt sich hier ein noch verlockenderer Wert: Nation bietet nicht nur einen Platz für die familienlosen, stammeslosen, sondern fordert, indem sie über Familie und Stamm hinausgeht, Loyalität - das Höchste im Reich der Nationalgefühle - gegenüber denjenigen, die nicht unmittelbar durch 'natürliche' Blutsbande oder durch Eigennutz mit der eigenen sozialen Einheit verbunden sind.
Zugehörigkeit dieser Art ist in der Tat keine Einbahnstraße. Sie stellt nicht nur einen passiven Wert dar: akzeptiert werden. Sie ist auch aktivisch zu verstehen: akzeptieren. Solange sie nicht mißbraucht wird, ist Loyalität eine jener Tugenden, welche sowohl den Gebenden als auch den Nehmenden zu Gute kommt.
Der andere zentrale Wert von Nation, im übrigen in gewisser Weise auch ein Instrument nationaler Abgrenzung, ist die Behauptung der Originalität. In dieser Lesart war der Turm zu Babel keine Sünde gegen Gott, sondern eine Sünde gegenüber dem Potential der Menschen; und die darauffolgende Zerstreuung war nicht Strafe, sondern göttlicher Segen. So gesehen ist die Nation, wie sie mit ihrer unendlichen Vielzahl an Eigentümlichkeiten Seite an Seite mit anderen Nationen existiert, das Medium, um menschliches Potential auf ganz unterschiedlichen Wegen zu verwirklichen, und die Menschheit wäre insgesamt ärmer, würden wir die Unterschiedlichkeit der Wege nicht kultivieren. [69] Wie man entscheidet, welche Einheit sich als Nation qualifiziert, ist ein interessantes Problem, bedarf jedoch hier keiner Vertiefung, ohnehin sind die Attribute, entlang deren diese Differenzierung erfolgt, hinreichend bekannt: Kultur (wovon Sprache mehr als nur ein Transportmedium darstellt) und Geschichte.
Bislang habe ich Zugehörigheit und Originalität in konzeptuellen Begriffen beschrieben - als 'Werte'. Jedoch haben diese Konzepte auch eine sozialpsychologische Komponente, aus der die ungaubliche Macht rührt, mit der Nation das menschliche Bewußtsein ergreift. Kombiniert ergeben sie den organisierenden Mythos, um den sich die 'Identität' einer Nation rankt. Identität in einer minimalistischen Ausprägung verweist auf essentielle und/oder konstruierte Eigenschaften, die Ähnlichkeiten zwischen Individuen nahelegen - weswegen man 'identisch' zu jemandem ist. Allerdings ist Nation im sozialen Sinne weitaus mehr als dieser Minimalimus. Die Nation privilegiert diese Eigenschaften und versteht sie als Mittel, Angehörige zu identifizieren, um dann die so konstruierten Angehörigen dazu aufzurufen, sich miteinander und mit dem Kollektiv zu identifizieren. Wie das, und warum?
Zugehörigkeit und Originalität zusammegefaßt zu einem organisierenden Mythos der nationalen Identität werden dargestellt als die Verkörperung des Schicksals. Es ist das vorgegebene Schicksal des einzelnen, in eine nationale Identität hineingeboren zu werden, ebenso wie es dem einzelnen vorgegeben ist, diese Identität zu wahren und ihr Potential auszuschöpfen. Dieser Griff auf das Bewußtsein, wie er sich im erstaunlichen Erfolg des Nationalismus bei der Einforderung von Loyalität manifestiert, ist aus meiner Sicht einfach zu erklären: Nation erwidert ein tiefes menschliches Verlangen - das Verlangen nach ontologischem metaphysischen Sinn. Das Schicksal, in eine Nation hineingeboren zu werden, bietet eine verführerische Antwort auf die Frage 'Wer bin ich?'. Das Schicksal, die Nation zu bewahren und ihr Potential zu verwirklichen, gibt eine gleichermaßen verführerische Antwort auf die Frage nach dem 'Weswegen bin ich hier?'.
Die Verkörperung der Werte Zugehörigkeit und Originalität in der Nation positiv zu beschreiben, wie ich dies getan habe, bedeutet keinesfalls, daß ich diese als auch nur entfernt adäquate ontologiche und metaphysische Antworten akzeptiere. Gleichwohl kann man nicht umhin, die Macht von Nation in diesem Sinne wahrzunehmen. Kritisch bleibt festzuhalten, daß eine solch große Macht über das menschliche Bewußtsein immense Gefahren birgt, sofern sie nicht ordentlich gehandhabt und eingedämmt wird.
An dieser Stelle kann man sich von der Nation dem modernen Staat zuwenden. Man sollte sich zu Beginn in Erinnerung rufen, daß die Existenz und sogar die lebendige Verwirklichung einer Nation nicht notwendig Staatlichkeit voraussetzen, auch wenn Staatlichkeit für die Nation vorteilhaft sein kann, nach innen und nach außen. Territorialität als grundlegendes Bindemittel stellt wohl das wichtigste der nach innen wirkenden Elemente dar. Die Bedeutung der Autochtonie bei der Festigung des nationalen Mythos kann gar nicht genug betont werden. Sprache, Kultur und Geschichte sind jeweils eingewoben in autochtonische Bilder. Man lebt aus dem Land, man verteidigt das Land, man stirbt für das Land, man wird im Land begraben. Auf der Gefühlsebene ist das jeweilige nationale Landschaftsbild mit seinen Farben, Gerüchen und wechselnden Stimmungen Gegenstand von Erzählungen, Balladen und Gedichten, von Träumen und Erinnerungen. Vom Anbeginn der Geschichte an war der Vorteil eines gelobten Landes für eine zusammenwachsende Nation anerkannt.
Nach außen wirkende Vorteile des Staates für die Nation ergeben sich aus der gegenwärtien Organisation der inh Unerläßliches hinaus, so geschieht dies im Dienste der Nation und ihrer Werte der Zugehörigkeit und Originalität. (Dieses Konzept betont, überbetont vielleicht, die Differenz zwischen dem amerikanischen, radikal alternativen liberalen Projekt eines nicht ethno-national geprägten Gemeinwesens einerseits und dem Staat als Republik andererseits, der Organisation und Normen über das Verhalten der Staatsangehörigen in den Mittelpunkt seines Wertesystems rückt.)
Jedenfalls ist evident, daß im Rahmen des europäischen Projektes Grenzen zu einem zentralen Merkmal des Nationalstaates werden.
Offenkundig gibt es zunächst einmal Grenzen im rechtlich-geographischen Sinne, die einen Nationalstaat vom anderen abgrenzen. Ebenso existieren jedoch innere, kognitive Grenzen, entlang derer die Gesellschaft (die Nation) und die Individuen sich selbst in der Welt wahrnehmen.
Auf einer gesellschaftlichen Ebene beinhaltet, wie gesagt, Nation das Ziehen von Grenzen, durch welche die Nation definiert und von anderen getrennt wird. Die Kategorien des Grenzziehens sind Legion: sprachlich, ethnisch, geographisch, religiös, etc. Das Ziehen der Grenzen ist genau dies: ein konstitutiver Akt, eine Entscheidung, daß gewisse Grenzen Bedeutung haben, sowohl für das Gefühl der Zugehörigkeit als auch für die Originalität der Nation. Dieses konstitutive Element ist besonders sichtbar im Moment des 'Nation Building', wenn Geschichte neu geschrieben wird, Sprachen wiederbelebt werden, etc. Zweifellos graben sich im Laufe der Zeit die Grenzen, insbesondere die nicht-geographischen, in das kollektive und individuelle Bewußtsein mit solcher Intensität ein, daß sie als natürlich erscheinen. Man denke nur an die eigentliche Austauschbarkeit des Wortes international mit universal oder global: in der sozialen Sphäre jedoch fällt es schwer, die Welt als ganzes zu beschreiben, ohne die Kategorie der Nation hinzuzuziehen (wie im Begriff international).
Schließlich impliziert Zugehörigkeit auch auf der Ebene des einzelnen eine Grenze: Man gehört dazu, weil andere nicht dazugehören.
So offensichtlich die Vorstellung von Grenzen zum Konzept des Nationalstaates gehört, so groß ist das Potential für einen Mißbrauch der Grenzen.
Mißbrauch kann erfolgen im Hinblick auf die drei wichtigsten Grenzen: die äußere Staatsgrenze, die Grenze zwischen Nation und Staat, und die innere Bewußtseinsgrenze derer, welche die Nation bilden.
Die extremste Form des Mißbrauchs einer äußeren Staatsgrenze ist physische oder sonstige Aggression gegen andere Staaten.
Der Mißbrauch der Grenze zwischen Gesellschaft und Staat ist am eklatantesten, wenn der Staat nicht mehr als Instrument für die Individuen und die Gesellschaft gesehen wird, das ihnen hilft, ihre Potentiale zu verwirklichen, sondern als Zweck an sich. In einer weniger extremen Form des Mißbrauchs, die dafür umso gefährlicher erscheint, trägt der Staat eine Art der 'Faulheit' in die Nation hinein - banale Staatssymbole etwa werden zum Ersatz für den eigentlichen und ursprünglichen nationalen Ausdruck. Dies mag auch Konsequenzen für das Gefühl der nationalen Identität haben, wenn nämlich der Staat und sein Apparat als Substitut für ein sinnvolles Gefühl der Zugehörigkeit und Originalität dienen. Der Staat wird dabei zum Instrumentalismus und zur Metapher für Schicksal, Treue zum Staat kann dann menschliche Verbundenheit, Einfühlungsvermögen, Loyalität und das Gefühl eines gemeinsamen Schicksals mit den Menschen, die das Staatsvolk bilden, ersetzen.
Es kann ebenfalls zu Mißbrauch der inneren Grenze kommen, die Zugehörigkeit definiert. Typisch hierfür ist, wenn sich eine Grenze, die ein Gefühl der Zugehörigkeit definiert, in eine Grenze wandelt, die ein Gefühl der Überlegenheit und ein begleitendes Gefühl der Herablassung oder Geringschätzung für die anderen ausdrückt. Die Idee der nationalen Identität beinhaltet einen 'anderen'. Es sollte jedoch nicht einen 'unterlegenen anderen' beinhalten.
Bekundungen dieser Mißbräuche sind lebendiger Teil der Geschichte des europäischen Nationalstaates, die so bekannt ist, daß sich eine Diskussion erübrigt.
Ein Großteil des Projektes der europäischen Integration kann als Versuch gesehen werden, die Exzesse des modernen Nationalstaates in Europa zu kontrollieren, und zwar insbesondere, aber nicht ausschließlich, die Tendenz zu gewaltsamen Konflikten sowie die Unfähigkeit der Beschränkung dieser Tendenz durch das internationale System. Die Europäische Gemeinschaft sollte das Gegenmittel zu den negativen Eigenschaften des Staates und des zwischenstaatlichen Verkehrs sein. Ihre Gründung im Jahre 1951 wurde als Beginn eines Prozesses gesehen, der ein Ende dieser Exzesse herbeiführen würde.
Aus historischer Sicht hat es, wie oben erwähnt, immer diese zwei konkurrierenden Visionen der europäischen Integration gegeben. Während niemand ernsthaft ein zentralisiertes Europa jakobinischer Prägung vorhergesehen hat, so ist doch klar, daß die eine Vision, die ich als Einheits-Vision oder Vision der Vereinigten Staaten von Europa bezeichnet habe, als ihren Idealtyp und ihr Ziel ein staatliches Europa, wenn auch föderaler Natur, postuliert. Das Europa von morgen würde in dieser Form in der Tat den Untergang des mitgliedstaatlichen Nationalismus bedeuten und die sich vormals zankenden Mitgliedstaaten ersetzen oder sie in eine politische Union in Gestalt eines föderalen Systems eingliedern.
Es ist leicht, einige der Schwächen dieser Vision auszumachen: Es wäre schon mehr als ironisch, wenn ein Gemeinwesen, das ins Leben gerufen wurde, um den Exzessen der Staatlichkeit entgegenzuwirken, zum Ausgangspunkt zurückfinden würde, indem es sich selbst in einen (Super-) Staat verwandelte. Gleichermaßen ironisch wäre es, wenn das Ethos, das den Mißbrauch der Grenzen des Nationalstaates zurückwies, ein Gemeinwesen gebären würde, das genau das gleiche Mißbrauchspotential besitzt. Das Problem dieser Einheits-Vision liegt darin, daß allein ihre Verwirklichung bereits ihre Negierung nach sich zieht.
Die alternative Vision, die sich historisch als dominierend erwiesen hat, ist die supranationale Vision, die Gemeinschaftsvision. Die Ziele sind hier gleichzeitig sowohl gemäßigt im Vergleich zu denen des Unionsmodells als auch reaktionär: bei Supranationalität, der Vorstellung der Gemeinschaft, nicht der Einheit, geht es um die Versicherung der Werte des liberalen Nationalstaates durch die Sicherung der Grenzen gegen Mißbrauch. Anders ausgedrückt könnte man sagen, daß Supranationalität zum Ziel hat, die Werte des Nationalstaates rein und frei von den oben beschriebenen Mißbräuchen zu erhalten.
Auf einer anderen Ebene ist das Projekt einer supranationalen Gemeinschaft weitaus ehrgeiziger und radikaler als das der Einheit. Es ist ehrgeiziger, da es - anders als das Projekt der Einheit, das die gegenwärtigen politischen Grenzen des Gemeinwesens innerhalb des existierenden nationalstaatlichen konzeptionellen Rahmens, wenn auch föderal, neu ziehen will - versucht, die Idee der Grenzen des Staates, zwischen Nation und Staat und innerhalb der Nation selbst neu zu definieren. Es ist radikaler, da es - wie ich zu erklären versuchen werde -, komplexere Ansprüche an die Akteure stellt und ihnen größere Beschränkungen auferlegt.
Wie aber berührt Supranationalität, in Gestalt des Gemeinschaftsprojektes der europäischen Integration, die Exzesse des Nationalstaates und den oben diskutierten Mißbrauch der Grenzen?
Auf der rein staatlichen Ebene ersetzt Supranationalität die 'liberale' Ausgangsvorstellung einer internationalen Gesellschaft durch die einer internationalen Gemeinschaft. Das klassische Modell des Völkerrechts ist eine Nachbildung der liberalen Staatstheorie auf der internationalen Ebene. Implizit wird der Staat auf internationaler Ebene so behandelt wie der einzelne auf staatlicher Ebene. Nach dieser Konzeption finden Begriffe des Völkerrechts - wie etwa Selbstbestimmung, Souveränität, Unabhängigkeit und Konsensus - offensichtliche Analogien in Theorien über das Individuum im Staat. In der supranationalen Vision wird die Gemeinschaft als transnationales Regime nicht nur eine neutrale Arena darstellen, in der Staaten ihre nationalen Interessen verfolgen und ihre Vorteile zu maximieren bestrebt sind, sondern sie wird auch eine Spannung zwischen dem einzelnen Staat und der Gemeinschaft der Staaten erzeugen. Entscheidend ist, daß die Gemeinschaft nicht dazu dienen soll, den Nationalstaat aufzuheben, sondern ein Regime zu schaffen, das es unternimmt, nationale Interessen durch eine neue Disziplin zu bändigen. Die Herausforderung besteht darin, auf gesellschaftlicher Ebene die unkontrollierten Refelexe nationaler Interessen in der internationalen Sphäre zu kontrollieren.
Auch im Hinblick auf die Grenze zwischen Nation und Staat soll Supranationalität Mißbrauch verhindern. Das supranationale Projekt anerkennt, daß auf einer Inter-Gruppenebene Nationalismus ein Ausdruck kultureller (politischer und/oder anderer) Besonderheiten ist, der die Verschiedenheit, die Einzigartigkeit einer Gruppe gegenüber einer anderen sowie Respekt für und Rechtfertigung der Aufrechterhaltung von Inter-Gruppen-Grenzen ausdrückt. Auf einer Intra-Gruppen Ebene ist Nationalismus Ausdruck kultureller (politischer und/oder anderer) Besonderheiten, welche die Gemeinsamkeit und das Teilende/Geteilte der Gruppe gegenüber sich sich selbst unterstreicht, der zu Loyalität aufruft und er rechtfertigt, Intra-Gruppen-Grenzen zu eliminieren.
Entscheidend ist jedoch, daß Nationalität nicht die Sache selbst ist - sie ist ihr Ausdruck, ein Artefakt. Ein überaus stilisiertes Artefakt, mit einem ganzen Apparat von Normen und Gebräuchen; vor allem nicht ein spontaner Ausdruck dessen, was sie kundtut, sondern ein Kode dessen, was sie ausdrücken soll, häufig übersetzt in rechtliche Gebilde. Nationalität ist unauflösbar mit Staatsangehörigkeit verbunden, Staatsangehörigkeit nicht einfach als Kode für Gruppenidentität, sondern auch als Paket von Rechten und Pflichten sowie sozialen Anschauungen.
Supranationalität strebt nicht an, das Zusammenspiel von Absonderung und Gemeinsamkeit, von Einbeziehung und Ausschluß und ihren potentiellen Wert als solches zu leugnen. Jedoch ist Supranationalität eine Herausforderung des kodifizierten Ausdrucks von Nationalität. In einer supranationalen Konstruktion mit ihren Regeln über die Grundfreiheiten, die keine Ausgrenzung anderer nationaler kultureller Einflüsse durch staatliche Mittel erlaubt und die ein striktes Verbot der an Staatsangehörigkeit anknüpfenden Diskriminierung enthält, kann nationale Differenzierung nicht ohne weiteres auf den künstlichen Grenzen ruhen, die der Staat vorgibt. Auf der Inter-Gruppen-Ebene drängt Supranationalität kulturelle Unterschiede dazu, sich in ihrer authentischen, spontanen Form auszudrücken und nicht in den kodifizierten staatlich-rechtlichen Formen. Auf der Intra-Gruppen-Ebene versucht Supranationalität, das falsche Bewußtsein abzustreifen, das Nationalismus schaffen kann, um stattdessen Zugehörigkeit, abgeleitet aus einem nicht-formalen Verständnis von Gemeinsamkeit, Raum zu geben. Hier stoßen wir möglicherwiese auf den ersten kantianischen Strang in dieser Konzeptionalisierung von Supranationalismus. Die Kantische Moralphilosophie gründet moralische Verpflichtungen auf die Fähigkeit der Menschen, nicht nur ethischen Normen zu folgen, sondern als rationale Geschöpfe für sich selbst die Gesetze ihres eigenen Handelns festzulegen und aus der inneren Entscheidung heraus, entsprechend dieser Normen, zu handeln. Supranationalität fördert nationale Kultur, wenn sie authentisch, internalisiert und ein wirklicher Teil der Identität ist.
Es gibt eine weitere aufklärerische, kantianische Idee in diesem Diskurs. Supranationalität, angesiedelt auf der gesellschaftlichen und individuellen Ebene eher als auf der staatlichen, verkörpert demnach ein Ideal, das die Bedeutung staatlicher Aspekte von Nationalität - wahrscheinlich der mächtigste Ausdruck von Gruppengefühl in unserer Zeit - als Hauptbezugspunkt für transnationalen menschlichen Austausch verringert. Das ist die Wertseite der Nichtdiskriminierung aufgrund von Staatsangehörigkeit, der Vorschriften über die Grundfreiheiten und ähnlichem. Hermann Cohen, der große Neu-Kantianer, versucht in seiner Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums [70] die Bedeutung des mosaischen Gesetzes, das die Nichtunterdrückung von Fremden fordert, zu erklären. In seiner Vision muß der Fremde geschützt werden, nicht weil er Angehöriger der Familie, des Clans, der religiösen Gemeinschaft oder des Volkes ist, sondern weil er ein Mensch ist. Im Fremden entdeckte der Mensch also die Idee der Humanität.
Dank dieser ausgezeichneten Exegese erkennen wir, daß das Gemeinschaftsideal der Supranationalität dadurch, daß es den totalitären Anspruch des Nationalstaates beschneidet und Nationalität und Staatsangehörigkeit als Bezugsprinzip für menschlichen Austausch reduziert, an die Ideen der Aufklärung mit der Privilegierung des Individuums, mit einer anderen Art von Liberalismus, die heute Nachkommenschaft in liberalen Vorstellungen von Menschenrechten findet, anknüpft und diese fortführt. In dieser Beziehung ist das Ideal der Gemeinschaft ein Erbe des aufklärerischen Liberalismus. Supranationalität nimmt eine neue, zusätzliche Bedeutung an, die sich nicht auf die Beziehungen zwischen Nationen bezieht, sondern auf die Fähigkeit des Individuums, sich über ihre oder seine nationale Beschränkung zu erheben.
Was, so lautet nun die Frage, ist die Natur der Angehörigkeit zu einem derartigen Konstrukt aus Gemeinschaft und Mitgliedstaaten? Hat dieses Konstrukt einen Demos? Kann es einen haben?
Diejenigen, für die das Volk dem Demos entspricht und dieser Demos die Basis für legitime Autorität in einer staatlichen Struktur darstellt, mögen fragen, wie es möglich ist, die Angehörigkeit zu einem Volk und die Staatsangehörigkeit anders als lediglich formal und semantisch zu trennen? Erzeugen nicht die Ideen von Volk und Nationalität mit ihrer organisch-kulturellen Fundierung im einzelnen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und in der nationalen Gemeinschaft ein Gefühl sozialer Kohäsion, die beide notwendig sind für das Bewußtsein von Pflicht und Loyalität, die wiederum Bedingungen für die Staatsangehörigkeit sind und sein sollen?
Ein gewisses Gewicht ist diesem Argument nicht abzusprechen. Die Kritik daran ist auch nicht, daß es zwingend falsch ist, sondern daß es ich um eine Weltsicht handelt, die man mehr oder weniger attraktiv finden kann. Jedenfalls ist sie bei weitem nicht zwingend. Ich möchte sie zunächst auf nationalstaatlicher und dann auf europäischer Ebene betrachten.
Zunächst einige Gründe dafür, an dieser Sicht schon im Hinblick auf die staatliche Ebene zu zweifeln:
Als erstes fällt die kümmerliche Vision von Individuum und Menschenwürde auf, die aus der Gleichung Volk-Staat-Staatsangehörigkeit folgt: Ist es für ein Individuum wirklich nicht möglich, sehr starke und tiefe kulturelle, religiöse und ethnische Anbindungen zu besitzen, die von der dominanten ethno-kulturellen Gruppe in einem Land abweichen, und trotzdem aufrichtig alle Rechte und Pflichten der Staatsangehörigkeit anzunehmen, sich ordentlich zu verhalten? Und wenn man auf die andere, gesellschaftliche Seite der Münze blickt: hat es der Staat nötig, einen solch umfassenden Anspruch auf die Seele des Einzelnen zu erheben; einen Anspruch, der an die Tage erinnert, als Christsein eine Bedingung für volle Zugehörigkeit zur bürgerlichen Gesellschaft und für umfassende Staatsbürgerrechte war - einschließlich des Rechts, staatsbürgerliche Pflichten zu besitzen?
Hervorzuheben ist, daß der Gedanke, Volk und Demos sowie Demos und Staat vollständig oder teilweise trennen zu wollen, nicht notwendigerweise eine Verunglimpfung der Tugenden der Nation - Zugehörigkeit, sozialer Zusammenhalt, kultureller und menschlicher Reichtum, der in der Erforschung und Entwicklung des nationalen Ethos gefunden werden kann - erfordert. [71] Die Frage besteht lediglich darin, ob Nationalität in diesem organischen Sinne, als Garant für die Homogenität des Gemeinwesens, die ausschließliche Bedingung vollständiger politischer und bürgerlicher Zugehörigkeit zum Gemeinwesen sein muß. Um es etwas schärfer zu formulieren: diese Konstruktion als unmöglich und/oder nicht wünschenswert abzulehnen bedeutet, dieselbe Weltsicht einzunehmen, die letztlich auch dem Konzept der ethnischen Säuberungen zugrundeliegt; damit unterstelle ich natürlich keinesfalls, daß das Bundesverfassungsgericht und seine Richter etwas anderes als Abscheu speziell diesem Konzept gegenüber empfinden. Aber die autoritativen Ausssagen des Bundesverfassungsgerichts über das deutsche Grundgesetz verkörpern nun einmal eine wichtige Stimme bei der Definition des Diskurses und des zivilen Ethos der öffentlichen Debatte.
Das ein derart verabscheuungswürdiges Konzept wie das der ethnischen Säuberung durchaus einen intellektuellen Nexus zu der Konstruktion aufweist, die Staatsangehörigkeit von Nationalität abhängig macht, um dann beides mit dem Staat zu verschmelzen, wird deutlich bei einem Blick auf einen herausragenden Vertreter dieser Ansicht, Carl Schmitt. Das Beharren auf 'Homogenität' als Voraussetzung zur Demokratie mag im eleganten Diskurs des Bundesverfassungsgerichts hinreichend harmlos klingen. Schmitt selbst jedoch, der Urheber des Freund/Feind-Konzepts des Politischen, konnte in dem Klima, in dem er schrieb, Euphemismen vermeiden und unverblümt die Implikationen der Konstruktion aussprechen. So findet sich in Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus folgender Satz: "Zur Demokratie also notwendig erstens Homogenität und zweitens - nötigenfalls - die Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen" (2. Auflage Berlin 1926, S. 14). Das und nicht weniger.
Der nächste Schritt ergibt geradezu natürlich. Unter anderem Bezug nehmend auf die Vertreibung der griechischen Bevölkerung aus der Türkei schreibt Schmitt: "Die Politische Kraft einer Demokratie zeigt sich darin, daß sie das Fremde und Ungleiche, die Homogenität Bedrohende zu beseitigen oder fernzuhalten weiß." (Id.)
Der letzte Schritt schließlich, in dem Theorie und Praxis zusammengeführt werden, ist ebenfalls keine Überraschung. Reichgruppenwalter Staatsrat Schmitt beruft 1936 eine Konferenz führender Juristen ein, um Das Judentum in der Rechtswissenschaft zu diskutieren. In der Schlußansprache zu dieser Konferenz scheut Schmitt nicht vor den Konsequenzen seiner theoretischen Äußerungen zurück: Die Säuberungen beginnen bei den Büchern ("Säuberung der Bibliotheken") und führen unweigerlich zur Dämonisierung der Autoren ("Der Jude hat zu unserer geistigen Arbeit eine parasitäre, eine taktische und eine händlerische Beziehung."). So wird dieses besonders heterogene Element zum "Todfeind". Die Logik von Schmitts Schußsatz ist unwiderlegbar klar, die Worte sprechen für sich selbst: "Was wir suchen und worum wir kämpfen, ist unser unverfälschte eigene Art, die unversehrte Reinheit unseres deutschen Volkes. 'Indem ich mich des Juden erwehre' sagt unser Führer Adolf Hitler, 'kämpfe ich für das Werk des Herrn'" (Schlusswort des Reichsgruppenwalters Staatsrat Prof. Dr. Carl Schmitt, in: Band 1. Die deutsche Rechtswissenschaft im Kampf gegen den jüdischen Geist, in: Das Judentum in der Rechtswissenschaft, Deutscher Rechts-Verlag, Berlin 1936).
Wie dem auch immer auf der Ebene von Staat und Nation letztlich sei, die Verschmelzung von Volk und Demos sowie von Demos und Staat ist als Modell für Europa offenkundig unnötig und nicht wünschenswert. Tatsächlich würde solch ein Modell Europa von seinem supranational zivilisierenden Telos und Ethos ablenken. Es gibt keinerlei Grund, einen europäischen Demos identisch zum Demos einer der Mitgliedstaaten zu definieren; dies gilt auch umgekehrt. [72]
Betrachten wir die Bestimmungen des Maastricht-Vertrages zur Unionsbürgerschaft:
Artikel 8
Es wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt.
Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates besitzt.
[...] [73]
Die Einführung einer an eine Staatsangehörigkeit/Staatsbürgerschaft angelehnte Unionsbürgerschaft in die konzeptionelle Welt der Union könnte als lediglich ein weiterer Schritt hin auf eine staatliche Vision der Einheit Europas gedeutet werden, insbesondere, wenn, wie im Deutschen bereits von der Vokabel her, Staatsangehörigkeit als Staatlichkeit voraussetzend verstanden wird. Ich habe mich zu den Gefahren dieser Möglichkeit an anderer Stelle bereits geäußert. [74]
Es gibt jedoch auch einen verlockenderen, wenn auch radikaleren Weg, die Regelung zu verstehen, nämlich als die tatsächliche konzeptionelle Abkopplung der Begriffe Nationalität/Volk von Staatsangehörigkeit und als Konzeption eines Gemeinwesens, in welchem Demos und Zugehörigkeit zuallererst in bürgerlichen und politischen anstatt organisch-kulturellen Begriffen verstanden werden. Nach dieser Auffassung umfaßt die Union Bürger, die per definitionem keine gemeinsame Nationalität besitzen. Die Substanz der Zugehörigkeit (und damit des Demos) besteht in einer Verpflichtung auf die gemeinsamen Werte der Union, wie sie in ihren Gründungsdokumenten niedergelegt sind, einer Verpflichtung unter anderem auf die Pflichten und Rechte einer bürgerlichen Gesellschaft, die verschiedene Bereiche des öffentlichen Lebens umfaßt, einer Verpflichtung zur Angehörigkeit zu einem Gemeinwesen, das gerade den Gegensatz zum Nationalismus betont - diejenigen menschlichen Grundzüge, welche die Verschiedenheiten des organischen Ethno-Kulturalismus transzendieren. So betrachtet sollte eine Konzeptualisierung eines europäischen Demos weder auf tatsächlichen oder imaginären transeuropäischen kulturellen Affinitäten oder gemeinsamer Geschichte, noch auf der Konstruktion eines europäischen 'National'-Mythos, wie er typischerweise zur Konstituierung der Identität der organischen Nation verwandt wird, fußen. Die Trennung von Nationalität und Staatsangehörigkeit eröffnet vielmehr die Möglichkeit, sich koexistierende, multiple Demoi vorzustellen.
Ein treffendes Bild der multiplen Demoi könnte als Modell 'konzentrischer Kreise' beschrieben werden. Demnach würde man sich gleichzeitig beispielsweise Deutschland und Europa zugehörig fühlen, oder gar Schottland, Großbritannien und Europa. Kennzeichnend für dieses Modell ist, daß das Gefühl der Identität und Identifikation der gleichen Quelle humaner Anbindung entspringt, wenn auch in unterschiedlicher Intensität. Vermutlich würde die intensivere Bindung (die Staat und Nation immer für sich in Anspruch nehmen) im normativen Konflikt stärker wiegen, und dies sollte auch so sein.
Die Vorstellung multipler Demoi, die ich vorschlage - eine wahrhaft variable Geometrie - lädt die einzelnen dazu ein, sich selbst als gleichzeitig zu zwei Demoi zugehörig zu verstehen, wenn auch basierend auf jeweils unterschiedlichen subjektiven Identifikationsfaktoren. Ich kann Deutscher im tiefgehenden, überaus mächtigen Sinne organisch-kultureller Identifikation und eines entsprechenden Zugehörigkeitsgefühls sein. Und gleichzeitig kann ich Unionsbürger/Unionsangehöriger (hier stoße ich wieder auf das bereits oben ausgeführte Problem, fürcitizen im Deutschen keine adäquate Entsprechung zu finden) im Sinne meiner transnationalen europäischen Affinität zu gemeinsamen Werten sein, Werte, welche die ethno-nationalen Unterschiede überwinden; dies in einem solchen Maße, daß ich in bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens gewillt bin, die Legitimität und Autorität von Entscheidungen, die von meinen europäischen Mit-Bürgern getroffen wurden, zu akzeptieren, weil ich in diesen Bereichen Entscheidungen meines außenbezogenen Demos denen meines innenbezogenen Demos den Vorzug gegeben habe.
So betrachtet entfernt sich der europäische Demos von seinen Vorgängern und dem Verständnis von Demos im europäischen Nationalstaat. Gleichzeitig sollte jedoch klar sein, daß ich hier mehr vorschlage, als amerikanischen Republikanismus schlicht nach Europa zu übertragen. Zunächst mögen die Werte, die in diesem Zusammenhang diskutiert werden, als spezifisch europäisch erscheinen; ich habe dieses Spezifische an anderer Stelle dargelegt. Um nur ein Beispiel zu geben: eine Dimension dieser Eigenart ist sicherlich das Grundmuster der gegenseitigen sozialen Verantwortung, verbunden mit dem Ethos des Wohlfahrtsstaates, wie es von allen Gesellschaften und politischen Kräften in Europa angenommen wurde. Aber der Unterschied zum Republikanismus amerikanischer Prägung besteht nicht nur in einem unterschiedlichen Menue bürgerlicher Werte, und hier geht diese Konstruktion in einigen Punkten auch weiter als der Habermassche Verfassungspatriotismus (obwohl diesem Konstrukt sehr viel zu verdanken ist). Auch im Falle Amerikas handelte es sich um 'Nationa Building', wenn auch unter anderen Voraussetzungen. Amerikas Endzustand, sein Mythos, wie er in dem Treuegelöbnis auf die amerikanische Flagge zum Ausdruck kommt - "One Nation, Indivisible, Under God" - ist aber nicht das, worum es sich bei Europa handelt: Bei Europa geht es eben genau nicht um "Eine Nation", nicht um einen Schmelztiegel usw., denn - trotz der unglücklichen Einheitsrhetorik - bleibt Europa weiterhin dem Ziel einer immer engeren Union der Völker Europas verpflichtet (oder sollte dem verpflichtet bleiben). Ebensowenig geht es um Unteilbarkeit oder, Gott sei Dank, um Gott.
Aber wo, so fragt man sich, bleibt in diesem Konzept des europäischen Demos das Gefühl, "zu Hause" zu sein, das so zentral ist für das nationale, organische Verständnis von Demos und das viel von seiner Anziehungskraft und seiner Legitimationskraft ausmacht? Eine teilweise Antwort läge in der Behauptung, daß die Rationalität bürgerlichen und politischen Engagements mindestens genauso viel normative Legitimation und zumindest für einige einen hohen Grad psychologischer Anbindung mit sich bringt. Ich werde hierüber weiter unten mehr sagen. Die Methapher des "Sich zu Hause Fühlens" mag sich jedoch als zweckmäßig dafür erweisen, meine Präferenz für das "variable Geometrie"-Verständnis der multiplen Demoi zu erklären.Ich möchte auf zwei verschiedene Wege aufmerksam machen, wie man sich "zu Hause" fühlen kann.
Im Rahmen des organischen Konzeptes von Demos entspringt das Gefühl des "zu Hause"-Seins der Verbundenheit und Nähebeziehung zu Landschaft und klassischer Kultur und dem Gefühl sozialer Ähnlichkeit. Ich bin dann zu Hause, wenn mir die Berge oder Seen oder Strände, die ich sehe, vertraut sind, wenn man die gleiche Sprache und Literatur, Musik und Gedichte, Essen und Aromen teilt, wenn die Leute - als Individuen - natürlich nicht ganz genau gleich sind; aber als Gruppe, als Nation sind sie "die meinigen". Ich bin "zu Hause" wegen Ähnlichkeit und Vertrautheit. Die Umgebung, im physischen und im sozialen Sinne, ist das Zuhause, einfach indem sie da ist. Ein bezauberndes Gefühl.
Es gibt aber sicher auch eine andere Art, sich "zu Hause" zu fühlen. Ich kann mich an einem fremden Ort zu Hause fühlen, wo die Berge und Seen und Strände anders sind, wo die Sprache und das Essen und die Mode merkwürdig erscheinen, wo die Gruppe der Menschen als solche zwar nicht "die meinige" ist, die Leute als Individuen aber so wie ich sind und mir das Gefühl des zu Hause-Seins geben. Ich bin "zu Hause" trotz der fehlenden organischen Ähnlichkeit und Vertrautheit aufgrund der bürgerlichen und politischen Kultur. Auch hierbei handelt es sich um ein bezauberndes Gefühl - für diejenigen, die geben, und diejenigen, die bekommen.
Die Ko-Existenz dieser beiden ist eine weitere Dimension multipler Demoi.
In dieser Lesart dürfen die Verträge nicht nur als Abkommen zwischen den Staaten (im Sinne einer Staatenunion) gesehen werden, sondern auch als 'Sozialvertrag' zwischen den Angehörigen dieser Staaten - ratifiziert in Übereinstimmung mit den verfassungsmäßigen Erfordernissen in allen Mitgliedstaaten -, die sich für die Bereiche, die vom Vertrag erfaßt werden, als Bürger zusammenschließen und sich als dieser bürgerlichen Gesellschaft zugehörig betrachten. Wir können sogar noch einen Schritt weiter gehen. In diesem Gemeinwesen und für diesen Demos ist ein Grundwert eben gerade, daß es keinen Sog hin zu einer umfassenden organisch-kulturellen nationalen Identität in Verdrängung derjenigen der Mitgliedstaaten geben wird, ebensowenig wie eine Akzeptanz einer solchen Identität. Angehörige der Mitgliedstaaten sind europäische Bürger, nicht umgekehrt. Europa ist 'noch nicht' ein Demos im organischen national-kulturellen Sinn und sollte es auch niemals werden.
Man sollte sich von dieser Konstruktion nicht davontragen lassen. Zunächst sei bemerkt, daß die Maastricht-Formel keine völlige Trennung umfaßt: Die Mitgliedstaaten sind frei, ihre eigenen Bedingungen der Angehörigkeit festzulegen, und diese können weiterhin in volksbezogenen Kategorien definiert werden. (Aber wir wissen, daß die Voraussetzungen für Nationalität und Staatsangehörigkeit von einem Mitgliedstaat zum anderen doch stark differieren). Darüber hinaus ist das Tor zur Unionsbürgerschaft die mitgliedstaatliche Staatsangehörigkeit. [75] Von größerer Bedeutung ist jedoch, daß auch diese Konstruktion des europäischen Demos, ebenso wie die volksbezogene, von einem Bewußtseinswandel abhängt. Einzelne müssen sich selbst auf diese Art begreifen, bevor ein solcher Demos volle legitime demokratische Autorität entfalten kann. Der Schlüssel zu einem Wandel der politischen Grenzen ist das Gefühl, daß die Grenzen das eigene Gemeinwesen umgeben. Weder behaupte ich, daß dieser Wandel bereits erfolgt ist, noch stelle ich irgendwelche Behauptungen hinsichtlich der Übertragung dieser Vision in institutionelle und konstitutionelle Ordnungen auf. Ich behaupte jedoch das folgende: A. Wir wissen nichts über das öffentliche Bewußtsein hinsichtlich eines auf einem bürgerlichen Gemeinwesen basierenden Demos, da die Frage nach dem emotionalen Bezug der Individuen erst in diesen bürgerlichen Begriffen gestellt werden muß, um eine sinnvolle Antwort zu erhalten. B. Dieser Wandel wird nicht stattfinden, wenn darauf beharrt wird, daß Demos lediglich volksbezogen verstanden werden kann. C. Daß dieses Verständnis von Demos die Notwendigkeit einer Demokratisierung Europas noch dringender macht. Ein Demos, der um Werte herum entsteht, muß diese Werte leben.
Es gibt einen letzten Punkt, der wohl die verborgenste Schicht der Kein-Demos-These berührt. Es ist eine Sache, wie im Maastricht-Vertrag vorgesehen, die Angehörigen der Mitgliedstaaten zu Bürgern der Union zu machen. Aber sind sie nicht gleichzeitig auch Angehörige der Mitgliedstaaten? Selbst wenn man akzeptiert, daß man Staatsangehörigkeit und Nationalität trennen und sich einen Demos vorstellen kann, der auf Angehörigkeit und nicht auf Nationalität beruht, kann man dann Angehöriger beider Gemeinwesen sein? Kann man nicht nur zu einem, sondern auch zu einem zweiten Demos gehören? Wir haben bereits die heftige Aversion eines Teils der deutschen Staatsrechtslehre gegenüber einer mehrfachen Staatsangehörigkeit erwähnt.
Ich möchte diese Frage auf zweierlei Art behandeln. Zum einen läßt sich einfach auf die relativ weitverbreitete Praxis von Staaten hinweisen, die eine doppelte oder mehrfache Staatsangehörigkeit gestatten. Ganz überwiegend schafft das in bezug auf bürgerliche Rechte und Pflichten kaum Probleme. Das trifft auch auf die Gemeinschaft zu. Zwar stimmt es, daß etwa im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung der Träger einer mehrfachen Staatsangehörigkeit sich in einer schwierigen Situation befindet. Kann aber nicht die Europäische Union selbst eine Konstruktion schaffen, die Krieg zwischen ihren Mitgliedstaaten nicht nur materiell unmöglich, sondern auch undenkbar macht? Die negative Einstellung gegenüber der mehrfachen Staatsangehörigkeit wurzelt, wie ich glaube, nicht in praktischen Erwägungen.
Vielmehr evoziert die Frage der doppelten Staatsangehörigkeit auf einer tieferen Ebene das Gespenst der gespaltenen Loyalität. Wer Europa den Status eines Demos verweigert, läßt sich womöglich vom Widerstand gegen die Idee der doppelten Loyalität leiten. Der Widerstand gegen eine doppelte Loyalität mag in der Angst begründet sein, daß eine flache, unscharfe, unauthentische und künstliche 'Euro-Kultur' die gewachsene, gut artikulierte, authentische und unverfälschte nationale Version derselben ersetzen wird. Sie mag auch auf dem Glauben beruhen, daß eine doppelte Loyalität zwangsläufig heißt, daß entweder eine oder beide Loyalitäten geschwächt werden. [76]
Hinsichtlich des ersten Punktes glaube ich nicht, daß irgendeine der europäischen organischen national-kulturellen Identitäten so schwach oder zerbrechlich ist, daß sie durch das Erscheinen einer simultanen bürgerlichen Loyalität gegenüber Europa gefährdet wäre. Ich habe bereits dargelegt, daß eher das Gegenteil wahrscheinlich ist. Von der formalen Struktur des Staates einmal gelöst, müssen nationale Kultur und Identität zu wahrhaft authentischen Ausdrucksmöglichkeiten finden, um Loyalität zu gewinnen, gewissermaßen eine wirklich innere Erzeugung. Darüber hinaus kann der existentielle Zustand des gespaltenen Selbst, des Lebens in zwei oder mehr Welten, nicht nur in einer Abschwächung von kulturellen Leistungen resultieren, sondern vielmehr zu deren Schärfung und Vertiefung. Wird irgendjemand, der Heine, Kafka oder Canetti gelesen hat, dies anzweifeln?
Was aber ist mit der politischen Aversion gegenüber doppelter Loyalität? Diese ist paradoxerweise am problematischsten, insbesondere in einem Gemeinwesen, das organische national-kulturelle Homogenität als Bedingung für Angehörigkeit hochhält. Es ist schwer zu sehen warum - außer wegen irgendwelcher mystischen Vorstellungen oder wegen echten Blutsbande- und Stammesdenkens - etwa einem britischen Bürger, der sich selbst als britisch versteht (und der immer mit einem englischen Akzent sprechen wird), der jedoch beispielsweise in Deutschland lebt und bereit ist, alle Rechte und Pflichten eines deutschen Staatsangehörigen zu erfüllen, im heutigen Europa nicht zugetraut werden kann, daß er dies loyal tun wird? Darüber hinaus haben wir bereits gesehen, daß die europäische Unionsbürgerschaft eine von der deutschen Staatsangehörigkeit sehr verschiedene Bedeutung haben würde. Die zwei Identitäten würden nicht 'auf dem gleichen Spielfeld' konkurrieren. Mir scheint, wie bereits gesagt, daß die Aversion gegenüber doppelter Loyalität, ebenso wie die Aversion gegenüber mehrfacher Staatsangehörigkeit selbst, nicht zuvörderst in praktischen Erwägungen wurzelt. Sie beruht auf einem normativen Verständnis, das nationale Selbstidentität - identifiziert mit dem Staat und seinen Organen - sehr tief in der Seele verankert sehen will, an einem Platz, der vormals der Religion gehörte. Dies klingt in der diesbezüglichen Metaphorik - dem Rückgriff auf das Schicksal - gelegentlich an. [77] Der Grund dafür ergibt sich aus der Feststellung, was die größte Anziehungskraft von Nationalismus ausmacht. Durch die Anklänge an Schicksal und Vorsehung kann Nationalismus das tiefste existentielle Verlangen erwidern, das Verlangen nach Sinn und Zweck der Existenz, die das schiere Existieren oder egoistische Selbstverwirklichung überschreiten. Religion nimmt sich mit größerer Legitimität dieser tieferliegenden Nischen der menschlichen Seele an und erhebt konsequenterweise einen Anspruch auf Ausschließlichkeit. Die Vermischung von Religion und Loyalität dem Staat gegenüber birgt aus meiner Sicht die Gefahr des Götzendienstes aus einer religiösen Perspektive, und aus politischer Sicht kann sie in höchstem Maße gefährlich sein. Historisch gesehen scheint es, als ob Volk und Staat, Blut und Boden in der Tat diese tiefsten Bereiche der menschlichen Seele besetzen konnten, bis zu dem Punkt, an dem sie 'über alles' gestellt wurden - mit den furchtbarsten Konsequenzen. Damit meine ich nicht, daß die eigentliche Idee von Volk und Staat mörderisch oder auch nur verderblich war, obgleich, wie wohl klar aus diesem Beitrag hervorgeht, meine Präferenz mehrfachen Loyalitäten, ja sogar Demoi innerhalb des Staates gilt. Es ist die Vorrangstellung, die die Mischung aus Volk und Staat okkupierte, die unkritische Loyalität erzeugte. Genau die führte dazu, daß schlimmste, ja sogar mörderische Konzepte ausgeführt wurden, indem kritische Stimmen und Persönlichkeiten unterdrückt, extreme Standpunkte legitimiert, transzendentale menschliche Werte unterjocht und eines der gemeinsamen Fundamente der drei monotheistischen Religionen, nämlich daß alle Menschen als Abbild Gottes geschaffen wurden, herabgewürdigt wurde.
Wie jedoch können wir 'kritische Loaylität' erreichen? Die Konstruktion Europas, die ich vorgeschlagen habe und die einen europäischen bürgerlichen, wertorientierten Demos Seite an Seite mit einem nationalen organisch-kulturellen (für die Nationalstaaten, die ein solches wollen) vorsieht, erscheint als eher bescheidener Beitrag zu diesem großen Ziel.
Vielleicht liegt in der Sphäre des Politischen die besondere Tugend einer gleichzeitigen Zugehörigkeit zu einem nationalen, organisch-kulturellen Demos und einem supranationalen, bürgerlichen und wert-gesteuerten Demos in der zähmenden Wirkung, die eine solche doppelte Angehörigkeit gegenüber der immensen Anziehungskraft, ja sogar Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Bestimmung in dieser Welt entfaltet, einer Anziehungskraft, die der Nationalismus noch immer ausübt, die jedoch so leicht zu Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit degenerieren kann. Vielleicht bieten der nach innen gerichtete nationale kulturelle Demos und der nach außen gerichtete, supranationale bürgerliche Demos, indem sie sich kontinuierlich gegenseitig in Schach halten, ein strukturiertes Modell kritischer Angehörigkeit. Womöglich lassen wir uns dadurch bei der Suche nach Sinn und Bestimmung vom starren Blick auf staatliche Strukturen, auf europäischer wie auf staatlicher Ebene abhalten. Vielleicht sollten wir die das mit einer mehrfachen Angehörigkeit verbundene, nämlich das politisch gespaltene Selbst und die doppelte Identität, die uns davor schützen, unsere Loyalität zu einem Gemeinwesen 'über alles' zu stellen, zelebrieren anstatt sie aus Abneigung zurückzuweisen. Vielleicht macht dieses Verständnis von Europa es für einige so anziehend, und so bedrohlich für andere.